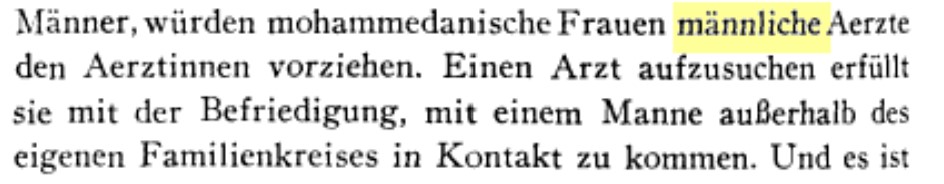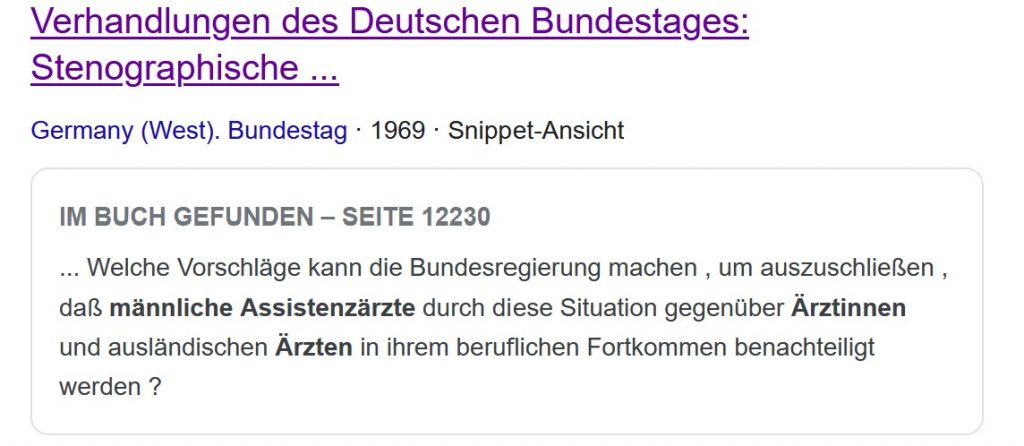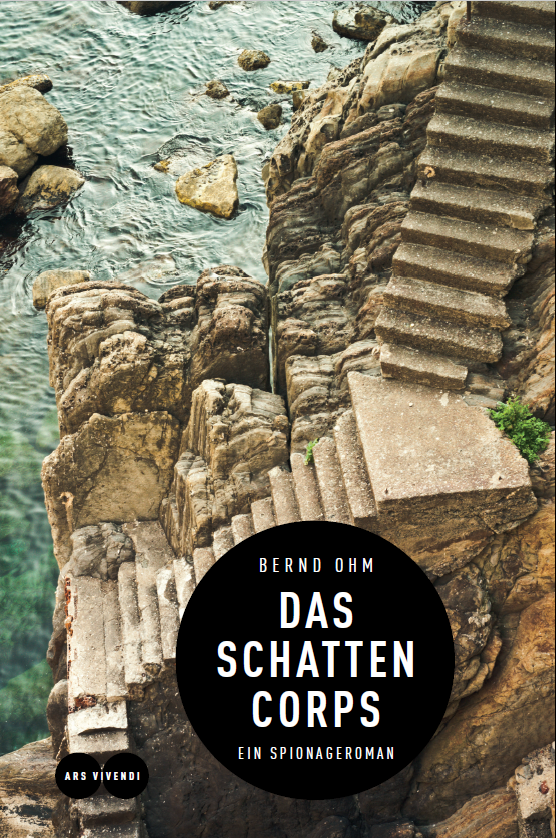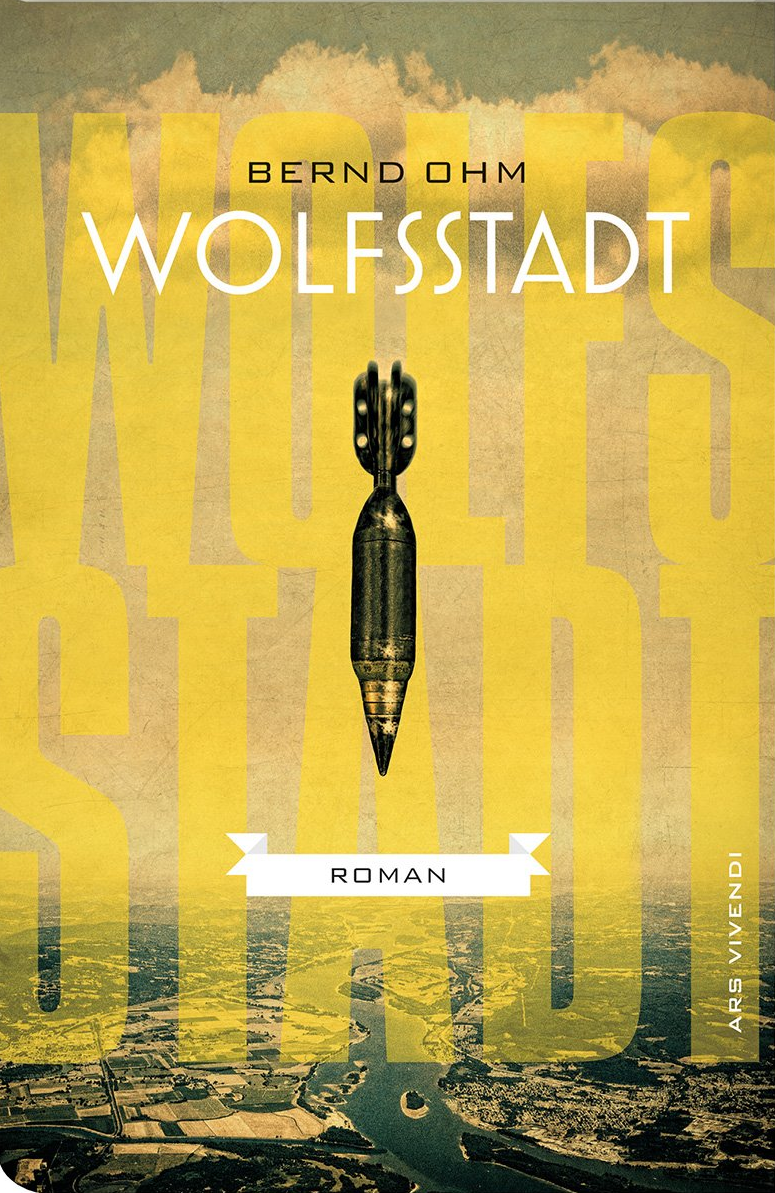In politischer Hinsicht ist beste Platz für einen Autoren zweifellos der zwischen allen Stühlen. Die Nation? Ein absolut notwendiges Übel, aber niemand wird mich jemals mit einer Flagge wedeln sehen, wenn irgendwo irgendwelche überbezahlten Sportskanonen einem Lederball hinterherrennen und sich »Nationalmannschaft« nennen. Der Sozialstaat? Einerseits zwingend notwendig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, anderseits – wenn man’s übertreibt – eine Einladung zum Faulenzen. Die freie Marktwirtschaft? Funktioniert unter bestimmten Umständen, unter anderen ist sie ein schlechter Witz. Der Kommunismus? Vor Gott und dem BGB mögen alle Menschen gleich sein, in jeder anderen Hinsicht sind sie es nicht. Und so weiter und so fort. Kein Standpunkt darf einem fremd sein, keine menschliche Regung unverständlich. Wie sollte man auch eine Geschichte schreiben, ohne sich noch in die übelsten und schrägsten ihrer handelnden Figuren hineinversetzen zu können …? Das heißt natürlich nicht, dass man überhaupt keine Prinzipien haben soll, aber wenn man die Welt durch die Brille dieser oder jener Ideologie sieht, verengt sich das Blickfeld, bis man nur noch das sieht, was man sehen will. Und nichts könnte langweiliger sein als Literatur, die sich irgendeinem Ismus verschrieben hat.
Trotzdem gibt es wohl manchmal Zeiten, in denen man es nicht vermeiden kann, in einem politischen oder gesellschaftlichen Streit für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen, weil er an die Substanz geht. Ich wünschte, es wäre nicht so, und ich könnte guter Dinge in meinem Krähwinkel hausen, ab und zu eine Geschichte heraushauen und ansonsten den Hund spazieren führen und meinen Kindern beim Großwerden zusehen. Aber, wie Flaubert sagte, ein Meer von Scheiße schwappt an die Mauern meines Elfenbeinturms und droht, seine Fundamente zum Einsturz zu bringen. Um das verständlich zu machen, muss ich zunächst ein wohl gehütetes Geheimnis verraten: Autoren – egal wie kunstbeflissen sie tun und wie erhaben über den Geschmack der breiten Masse sie sich auch geben mögen – möchten gelesen werden. Und zwar von so vielen Menschen wie möglich. Ausnahmslos jeder von uns. Wir möchten auch, dass unsere Bücher besprochen werden; ob nun positiv oder negativ, ist gar nicht so wichtig, denn man möchte irgendetwas bewirken (und sei es nur, dem Leser einen angenehmen Zeitvertreib zu verschaffen), sonst würde man sich nicht monatelang an den Schreibtisch setzen und nach dem richtigen Wort suchen, wenn es ein x‑beliebiges schon irgendwie auch täte.
Um aber gelesen oder besprochen zu werden, gibt es ein paar unabdingbare Voraussetzungen. Dazu gehören ein Verlag (oder ein erfolgreiches Self-Publishing), ein gutes Lektorat, eine wirksame Vermarktung und das Quäntchen Glück, zur richtigen Zeit das richtige Thema gefunden zu haben. Es gibt allerdings etwas, auf das man in dieser Hinsicht noch viel weniger verzichten kann. Es ist so selbstverständlich, dass man vielleicht gar nicht darauf kommt, aber es ist gerade diese Selbstverständlichkeit, die einem angesichts der aktuellen Entwicklungen Angst und Bange macht: Autor und Leser brauchen eine gemeinsame Sprache. Bumm. Da haben Sie’s. Aber wo ist denn da das Problem, werden Sie fragen. Und ich werde antworten: Wo ist es bitte schön nicht? Die altehrwürdige hochdeutsche Schriftsprache, in der ich meine Bücher verfasse, steht von zwei Seiten unter Beschuss, und mit beiden ist nicht zu spaßen. Von der einen Flanke reißen die Globalisierung und die Ausbreitung des Englischen als Standardsprache von Wissenschaft, Wirtschaft und Unterhaltungsindustrie heftige Lücken in das gebildete Bürgertum, das überwiegend als Lesepublikum von Romanen in Frage kommt. Websites deutscher international tätiger Konzerne weisen mittlerweile oftmals nicht mal mehr eine deutsche Sprachoption auf, und die Einführung des Englischen als Lingua Franca an der Uni und für die unternehmensinterne Kommunikation weckt zwar mitunter eher Erinnerungen an die legendären Lübke-Bonmots (sag ich mal boshafterweise als Anglist, der sich im Brotjob in der globalisierten Wirtschaft herumtreibt), beschränkt aber auf jeden Fall die Nutzung des Hochdeutschen immer weiter auf Schule, Ämter und privates Umfeld. Die nachfolgenden Generationen sind dann schon potenzielle Konsumenten von internationaler Literatur, die sie gleich im Original lesen. Einige Kollegen hier in Deutschland haben drauf reagiert, indem sie ihren Büchern von vorneherein englische Titel geben und die Plots in dem amerikanischen Vorstadt- oder Universitätsmilieu ansiedeln, das mittlerweile sowieso jeder besser zu kennen meint als die eigene Nachbarschaft. »Die Amerikaner haben unser Unterbewusstsein kolonialisiert!« rief Hanns Zischler vor über vierzig Jahren in Wim Wenders betörend schönem, aber längst vergessenem Film Im Lauf der Zeit. Mittlerweile sind sie da deutlich weiter vorangekommen.
Um die zweite Angriffslinie zu verstehen, von der aus die Sprache bedroht wird, die ich mit meinen Lesern bisher geteilt habe, muss ich Sie auf einen kleinen Umweg mitnehmen. Wir leben hier in einem renovierten Bauernhaus, in dem meine Familie seit ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts ansässig ist. Da es sich nur um eine kleine Landwirtschaft handelte, mussten meine Vorfahren sich noch anderweitig verdingen; ein paar Generationen lang betrieben sie eine Wagenmacherei, mein Urgroßvater wechselte das Metier und war Verwalter auf einem in der Nähe liegenden Gutshof, mein Großvater und Vater arbeiteten beim Wasserbau. Eine solche Stelle nannte man in Nordwestdeutschland früher »Brinksitz«, und jeder Brinksitzer hatte in der bis ins 19. Jahrhundert in der Talaue der Weser herrschenden Zweifelderwirtschaft das Recht, zwei oder drei Kühe auf dem jeweils brachliegenden Teil des Dorfackers in der Marsch weiden zu lassen. Als diese kollektiv organisierte Bewirtschaftung so um 1830 herum aufgegeben wurde, erhielten die Kleinbauern und Handwerker zum Ausgleich einen Teil des Dorfangers, den sie von nun an als Privatweide nutzen konnten. Das war ein ziemlich schlechter Deal, jedenfalls kriegt man auf der Weide, die nun uns gehörte, nicht mal eine einzige Kuh satt …! Meine Vorfahren ergaben sich ins Unvermeidliche und verlegten sich – wie die meisten anderen Brinksitzer auch – auf die nebenher ausgeübte Schweinezucht. Als ich klein war, bestand einer meiner ersten Jobs darin, unser Borstenvieh morgens die Lohmannspecken herunter auf die betreffende Weide zu treiben und sie abends wieder in den Stall zu holen. Klingt urig, oder? War es auch.
In jedem Fall gab es 1830 noch keinen Stacheldraht, allzu viele Bäume zum Gatterbauen findet man in unserer Gegend auch nicht, also musste zum Einpferchen der Tiere eine Hecke gepflanzt werden, deren Überreste sich noch heute die Lohmannspecken (schon gut, schon gut, so heißt die Straße) entlang ziehen. Hier sind sie:
Schauen wir uns eines der Gehölze näher an, aus denen die Hecke besteht:
Was würden Sie sagen, ist das ein »Baum«, oder ist es ein »Strauch«? Oder ein »Busch«? Ein »Heckengehölz«? Maximal drei Meter hoch, kein Stamm, wild durcheinander wuchernde Zweige – für meinen Geschmack ein klassischer Busch. Ein »Baum« ist es jedenfalls nicht. Im Gegensatz dazu ist das große Ding hier ja wohl auf jeden Fall einer:
Alles daran ist geradezu mustergültig baumartig: die Höhe (bestimmt 15 Meter), der dicke Stamm in der Mitte (sieht man auf dem Bild nicht so gut), die ebenso dicken, in die Breite und nach oben strebenden Äste. Sehen wir uns die Blätter etwas näher an:
Die kleinen grünen Früchte werden im Laufe des Sommers rot und werden dann von Vögeln aller Art gerne als Nahrung genommen. Marmelade kann man auch daraus machen. Beides gilt übrigens auch für den Busch, den wir am Anfang des kleinen Ausflugs gesehen haben. Gehen wir nochmal zurück:
Hm … Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch auffällt, aber das sieht ziemlich gleich aus, oder? Na gut, ich gebe es ohne Umschweife zu, ich wollte Sie hinters Licht führen. Es handelt sich tatsächlich um dieselbe Pflanzenart, nämlich einen eingriffeligen Weißdorn, Crataegus monogyna, auch »Hagedorn« genannt, weil man ihn früher häufig zum Anlegen von Hecken verwendete. Das Riesenexemplar auf dem zweiten Bild hat sich von selbst angesiedelt, und da mein Vater die Landwirtschaft Mitte der 1970er ganz aufgab, wurde die Weide nicht mehr benötigt, und er achtete nicht mehr so stark darauf, die Ränder frei von Wildgehölz zu halten.
Aber, so könnte man fragen, was ist denn nun ein Weißdorn eigentlich, ein »Baum« oder ein »Busch«? Die Antwort lautet natürlich, dass es der Pflanze vollkommen egal ist, wie wir sie nennen, sie wächst halt in Einzellage in die Höhe wie ein Baum, während sie im engen Verband mit anderen Pflanzen eher wie ein Busch aussieht. Und die weitergehende Antwort lautet – und damit betreten wir das weite Feld der Sprachphilosophie –, das nichts irgendetwas »ist«. Sie haben richtig gelesen: nic, nada, niente. Die Kategorien, in die wir die Welt einteilen und mit »Wörtern« genannten Lautfolgen assoziieren, entstehen ausschließlich in unserem Kopf, und sie haben den ausschließlichen Zweck, uns die sinnvolle Kommunikation mit unseren Mitmenschen über eben diese Welt (der die Linguistik die schöne Bezeichnung »außersprachliche Realität« gegeben hat) zu ermöglichen. Je nach Kontext kann dasselbe Gewächs mit einem anderen Namen belegt werden: Wenn ich meinem Sohn sagen will, welche Bäume gefällt werden sollen, weil wir für den nächsten Winter Brennholz brauchen, werde ich den Weißdorn auf dem zweiten Bild als »Baum« bezeichnen. Wenn es um den Vogelschutz geht, werde ich ihm erklären, dass wir den »Busch« auf dem ersten Bild deshalb nicht wegmachen, weil er Platz für Nester und Nahrung im Winter bietet. Und wenn ich Marmelade machen will, ist beides ein »Weißdorn«, denn dann kommt es nicht auf die Form an, sondern auf die Art der Früchte. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat das sehr viel prägnanter als ich ausgedrückt:
Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.
Über diesen Satz könnte man ganze Bibliotheken vollschreiben, belassen wir es an dieser Stelle dabei, dass Wörter nicht die Widerspiegelungen irgendwelcher naturgegebenerund unveränderlicher Wesenheiten sind, die sozusagen hinter den Dingen existieren und die Grundlage der Welt bilden, also in etwa von dem, was Platon als »Idee« bezeichnete und für die eigentliche Wirklichkeit hielt. Es gibt keinen »Baum an sich« und keinen »Busch an sich«, sondern stattdessen nur eine verwirrende Vielfalt von Sinneseindrücken, die wir mit unserer Sprache so gut es irgend geht in halbwegs sinnvolle Kategorien zu ordnen versuchen. Wörter sind immer nur vorläufige Hypothesen über die Welt, die ihre Tauglichkeit stets von neuem in der Kommunikation mit anderen beweisen müssen.
Dieser Tauglichkeitstest ist allerdings von entscheidender Bedeutung: Man kann den Weißdorn als »Baum« oder als »Busch« bezeichnen, aber nicht als »Rose« oder gar als »Kaffeetasse«, denn dann ist die Kommunikation nicht mehr sinnvoll. Als ich noch zum Zielpublikum des westdeutschen Kinderfernsehens gehörte, wurde dort manchmal Peter Bichsels höchst lehrreiche Geschichte Ein Tisch ist ein Tisch erzählt. Sie handelt von einem alten Mann, der die Gewöhnlichkeit und Langeweile des Alltags nicht erträgt und eines Tages spontan auf die Idee kommt, dadurch eine Abwechslung herbeizuführen, dass er sein Bett von nun an »Bild« nennt. Die Sache gefällt ihm, und er bezeichnet als Nächstes seinen Tisch als »Teppich«, seinen Spiegel als »Stuhl«, sein Bild als »Tisch« usw., bis er schließlich alle Wörter ausgetauscht und eine völlig neue Sprache erfunden hat, »die ihm ganz allein gehört«. Genau das ist natürlich das Problem, denn jetzt versteht ihn niemand mehr, sodass er schließlich als einsamer Sonderling endet, der nur noch Selbstgespräche führt.
Das ist eine schöne Illustration dessen, was Wittgenstein »Privatsprache« nannte: eine Sprache, deren Bedeutung nur eine einzige Person kennt. Außerdem zeigt sich daran eine der faszinierendsten Eigenschaften von Sprache überhaupt, nämlich die erstaunliche Tatsache, dass sie sich auch ohne jede Steuerung von außen mehr oder weniger von selbst reguliert. Wenn man mit anderen Menschen kommunizieren will, muss man sprechen, wie man es in der Kindheit oder im Sprachkurs gelernt hat, sonst wird man eben nicht verstanden. Manche Länder haben eine offizielle Institution, die für die Herausgabe eines Wörterbuchs der Nationalsprache zuständig ist und auf deren »Reinheit« achtet, etwa die Académie francaise oder die Real Academia Española. Im Grunde funktioniert es aber, wie man an Deutschland oder den angelsächsischen Ländern sieht, genauso gut auch ohne: Man befolgt bestimmte Kommunikationsregeln nicht deshalb, weil irgendeine zentrale Instanz dies fordern würde, sondern weil man mit seinen Sprachäußerungen irgendetwas erreichen und verstanden werden will.
In einer halbwegs freien Gesellschaft, in der Sprache nicht von oben diktiert wird, ist es deshalb sehr schwer, die Bedeutung eines Wortes ändern zu wollen, weil man dabei jedes Mal gegen den gesamten Rest der Sprachgemeinschaft ankämpfen muss. Die Schwulenbewegung hat mehrere Jahrzehnte gebraucht, bis aus der Beleidigung »schwul« die stolze Selbstbezeichnung des Berliner Bürgermeisters Klaus Wowereit wurde, und auch da ging es nur um Tonfall des Wortes, nicht um dessen Grundbedeutung, die weiterhin »sich als Mann von Männern sexuell angezogen fühlend« lautet. Etwas leichter haben es Diktaturen, die den von ihnen Beherrschten befehlen können, sich von heute auf morgen mit »Heil Hitler« zu begrüßen oder die Menschen jenseits der Westgrenze als »Klassenfeind« zu bezeichnen. Aber auch das verschwindet wieder, sobald das jeweilige Regime im Orkus der Geschichte verschwunden ist. Der Beharrungswille von Sprache ist stark.
*
Ihnen ist in letzter Zeit vielleicht aufgefallen, und damit wären wir wieder beim Thema dieses Blogposts, dass meine kurzen Ausführungen zu Sprache und Wirklichkeit nicht von sämtlichen zeitgenössischen Sozial- und Geisteswissenschaftlern geteilt werden, und daran ist der erwähnte Wittgenstein nicht ganz unschuldig. In seinem Tractatus logico-philosophicus hatte er noch ein Prinzip formuliert, das unmittelbar einleuchtet und als »Abbildtheorie der Sprache« bezeichnet wird:
Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie wir sie uns denken.
In den später erschienenen Philosophischen Untersuchungen führte er hingegen den nicht ganz ungefährlichen Begriff »Sprachspiel« ein, unter dem er eine sprachliche Äußerung in ihrer Einbettung in eine bestimmte Situation und Verwendungsabsicht verstand. Das steht nicht notwendigerweise im Gegensatz zur besagten Abbildtheorie, und der Begriff an sich kann sinnvoll und nützlich sein, aber die von dem Wort »Spiel« hervorgerufenen Assoziationen (und andere Faktoren) haben sich leider für Wittgensteins Nachfolger als Einladung erwiesen, großräumig die Bodenhaftung zu verlieren und Sprache als Phänomen zu interpretieren, das hauptsächlich seinen eigenen Regeln gehorcht und nicht etwa der Kommunikation über die Realität dient, sondern schlimmstenfalls als »Diskurs«, »Machtspiel« oder »Wissensspiel« die Aufrechterhaltung von Machtverhältnissen zwischen Menschen gewährleistet.
Damit haben wir uns in die Untiefen der postmodernen Philosophie begeben, die ich an dieser Stelle keinesfalls im größeren Ausmaß diskutieren werde. Das ist auch gar nicht nötig, denn der entscheidende Punkt daran ist, dass man im Grunde das erste Wittgensteinzitat oben nimmt und daraus folgert, dass unser Zugang zur Wirklichkeit durch Sprache überhaupt erst »konstruiert« wird (was ja an sich nicht falsch ist), dabei aber übersieht, dass diese Konstruktion natürlich nicht beliebig sein kann, sondern in einem möglichst hohen Grad mit einer unabhängig vom Sprechenden tatsächlich vorhandenen Wirklichkeit korrelieren muss, um eine sinnvolle Kommunikation über diese Wirklichkeit und ein sinnvolles Handeln darin zu ermöglichen. Stattdessen verabsolutiert man die Rolle der Sprache derart, dass die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, selbst ein sprachliches Konstrukt sei und daher dem souveränen Willen des Menschen unterliege, und von diesem Punkt aus verschwinden dann Denker wie Michel Foucault oder Judith Butler in ein Paralleluniversum, in dem es keine objektive wissenschaftliche Erkenntnis mehr gibt, weil alles Wissen nur ein Machtspiel ist, und ein Mensch sich aussuchen kann, welches Geschlecht er besitzt, indem er den Diskursen der Herrschenden, die ihn in binäre Kategorien zwängen wollen, seine innere autonome Wahrheit entgegensetzt. Kurz gesagt: eine Welt, deren Bewohner mit kaum etwas anderem beschäftigt sind, als darum zu kämpfen, wer von ihnen die Realität definieren kann.
Wie Sie sich denken können, hat die postmoderne Denkweise auf jemanden, dessen erster Job im Schweinehüten in der elterlichen Landwirtschaft bestand, keinen besonders großen Eindruck gemacht. Ich habe das auch lange ignoriert und darauf vertraut, dass der gesunde Menschenverstand sich am Ende schon irgendwie wieder durchsetzen wird. Wie die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, hätte ich mich wohl nicht gründlicher täuschen können. Sehen wir uns unter diesem Aspekt ein paar der sprachlichen Phänomene an, die in letzter Zeit aus besagtem Paralleluniversum in unsere Welt herübergeschwappt sind!
Schwarzfahrer
Sie haben es sicher gehört, in München und Berlin haben die Verkehrsbetriebe diesen Begriff aus ihrem offiziellen Wortschatz gestrichen, da er möglicherweise Menschen mit dunkler Hautfarbe beleidigen könnte. Ich muss zugeben, dass mich der Vorgang zunächst ein wenig verblüfft hat. Als ich so Anfang zwanzig war und in der Isarmetropole studierte, war das Fahren ohne Fahrschein – jedenfalls in bestimmten Studentenkreisen – keinesfalls negativ besetzt, sondern der erste Schritt auf dem Weg in eine gerechte Welt, in der die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel selbstverständlich kostenfrei zu sein hatte. Und Geld sparte man ja auch. Ich erinnere mich noch wehmütig der spannenden Verfolgungsjagden, die ich mir mit den MVV-Kontrolleuren lieferte, einmal musste ich sämtliche Treppen des U‑Bahnhofs am Sendlinger Tor hochrasen, bis ich sie abgeschüttelt hatte … Heute zahle ich natürlich jeden Fahrschein!
Aber zurück zur Linguistik: In den Medien wurde viel Wirbel darum gemacht, dass sich »Schwarzfahrer« von einem angeblichen jiddischen Wort für »arm« herleite, aber das ist wahrscheinlich falsch und außerdem unerheblich, da ja niemand beim Sprechen eine Wortherkunft mitdenkt. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang eine grundlegende Eigenschaft von Sprache, nämlich dass sie mit Metaphern arbeitet. Man nimmt irgendein Wort oder eine Wendung, überträgt die Bedeutung auf einen anderen Kontext, und wenn sich die übertragene Verwendung eingebürgert hat, vergisst man (immer an Wittgenstein denken) in diesem Kontext die ursprüngliche Bedeutung und hat sozusagen ein neues Sprachspiel erschaffen. Manchmal ist die neue Bedeutung positiv, manchmal ist sie negativ, so auch bei der Metaphernbildung auf der Grundlage von Farben: Grün ist des Lebens goldener Baum, aber manchmal ist man auch grün vor Neid; man fährt ins Blaue, lügt aber auch dieselbe Farbe vom Himmel herab; mit Rot wird für gewöhnlich die Liebe assoziiert, aber Zornesröte steht niemandem gut. Sogar Schwarz als Abwesenheit aller Farben ist nicht ausschließlich negativ besetzt, schließlich kann man ins Schwarze treffen oder schwarze Zahlen schreiben. Entscheidend dabei ist, das das »Schwarz« etwa in »Schwarzarbeit« und das gleich lautende Wort im »kleinen Schwarzen« nichts miteinander zu tun haben außer dem (neutralen) Farbeindruck, der irgendwann am Beginn der Metaphernbildung stand. Jedes Sprachspiel steht für sich und gehört in seinen jeweils eigenen Kontext. Im Gegensatz dazu weisen die zuständigen Leute bei den Verkehrsbetrieben der Lautfolge [ʃvaʁʦ] eine geradezu magische Bedeutung zu, die demzufolge automatisch zu abwertenden Gedanken über Menschen mit dunkler Hautfarbe führen würde, und sie unterstellen uns, dass wir grundsätzlich nicht zwischen den jeweiligen Bedeutungen der verschiedenen Sprachspiele unterscheiden könnten.
Das gilt übrigens auch ganz grundsätzlich für die Bezeichnung »Schwarze«, die ja tatsächlich manche Leute im Kontext der übelsten Schmähungen verwenden, aber genauso gut kann man dabei an die Schönheit Naomi Campbells denken oder die Eleganz der schwarzen Basketballer, die wir als Harlem Globetrotters kennen. Wie kommt man also zu dieser seltsamen Assoziation von »Schwarzfahrer« mit Rassismus? Ich glaube, daran ist Pepe Danquarts gleichnamiger Kurzfilm schuld, der 1994 mit dem Oscar für den besten Kurzfilm ausgezeichnet wurde und dadurch eine größere, für dieses Genre unübliche Medienpräsenz erhielt. Die Handlung ist eine Art verfilmtes Wortspiel: Ein junger Dunkelhäutiger wird in der Berliner Straßenbahn von einer älteren Frau mit rassistischen Beleidigungen überhäuft, wehrt sich dagegen auf witzige Weise und macht die Alte dadurch zur Schwarzfahrerin, die dann vom Kontrolleur erwischt wird, während im Hintergrund ein echter Nichtzahler entwischt. Es war sicher nicht die Absicht des Regisseurs, aber irgendwie muss sich dadurch die Verbindung zwischen dem Fahren ohne Fahrschein und bösen alten Vetteln, die keine Afrikaner mögen, in die Köpfe des Publikums eingeschlichen haben, sodass es heute einigen davon als irgendwie geboten erscheint, nicht mehr »Schwarzfahrer« zu sagen. Jede andere Erklärung wäre jedenfalls absurdes Theater.
Das Verschwinden des generischen Maskulinums
Ein harter Brocken, ich gebe es zu. Die Verdammung der grammatisch männlichen Wortform in biologisch geschlechtsneutraler Verwendung hat sich mittlerweile von den Universitäten über die öffentliche Verwaltung bis hin zu den Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender derart breitgemacht, dass man man kaum noch darauf hoffen kann, den Schlamassel wieder rückgängig zu machen. Hier ist trotzdem ein Versuch:
Haben Sie sich eigentlich jemals gefragt, warum es drei grammatische Geschlechter gibt …? In der historischen Abteilung der Sprachwissenschaften gibt man darauf die Antwort, dass die Substantive in der indogermanischen Ursprache ursprünglich in die Kategorien »belebt« und »unbelebt« aufgeteilt waren (falls Sie mal eine slawische Sprache lernen sollten – dort spielt das für bestimmte Konjugationsklassen immer noch eine Rolle), später hat man dann offensichtlich das Bedürfnis verspürt, unter den »belebten« Wörtern noch eine weitere Kategorie einzuführen, mit der speziell weibliche Wesen bezeichnet wurden. Dass wir diese Einteilung »Geschlecht« nennen, haben wir einer etwas einengenden Lehnübersetzung des entsprechenden lateinischen Begriffes genus zu verdanken, der neben dem biologischen Geschlecht auch so etwas wie »Herkunft«, »Stand«, »Gattung«, »Art« oder dergleichen bezeichnet.
Im Laufe der Zeit wurden dann neue Wörter erfunden oder aus anderen Sprachen übernommen, die aus heute nicht mehr transparenten Gründen der einen oder anderen Wortkategorie zugeschlagen wurden, sodass wir irgendwie zu dem jetzigen System gekommen sind, das ja ein ziemliches Kuddelmuddel ist und eine nur sehr vage Übereinstimmung des grammatischen mit dem biologischen Geschlecht erkennen lässt. Aber auch das ist eine grundlegende Eigenschaft von Sprache – niemand hat sich hingesetzt und die bestmögliche Kategorisierung ausgearbeitet, mit deren Hilfe man die Wirklichkeit beschreiben kann, es hat sich alles einfach irgendwie ergeben. In meiner Studienzeit war dafür das Modewort »Fuzzyness« im Schwange, das man der Computersprache entnommen hatte, und das Schöne daran ist, dass es vollkommen egal ist. Obwohl Sprache so ein unvollkommenes System ist, wissen wir trotzdem in der Regel immer, was gemeint ist. Um den Grund dafür zu verstehen, lohnt es sich, an dieser Stelle nochmal Wittgenstein zu wiederholen (es ist wirklich ein sehr wichtiger Satz):
Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.
In Bezug auf das generische Maskulinum heißt das: Wenn die Regel eines Sprachspiels lautet, dass man in einem bestimmten Kontext die grammatisch maskuline Form eines Substantivs verwendet, um dieses als abstrakte Funktion darzustellen, und die anderen Angehörigen der Sprachgemeinschaft das auch so verstehen, dann ist das – und nichts weiter – seine Bedeutung. Oben erwähnte ich ja schon, dass man die Wortherkunft beim Sprechen nicht mitdenkt; für die grammatische Kategorie gilt dies ganz genauso. Niemand stellt sich einen konkreten Arzt vor (welchen Geschlechts auch immer), wenn er sagt »Ich habe Schmerzen, ich muss mal zum Arzt«.
Das war natürlich nicht immer so. Ganz früher übten Männer und Frauen in der Regel unterschiedliche Funktionen und Berufe aus, sodass in jedem Fall klar war, das mit »Arzt«, »Bürgermeister« oder »Student« ein Mann gemeint war. Allerdings konnte damals schon jeder dieser Begriffe sowohl auf konkrete Personen als auch auf die von diesen ausgeübte abstrakte Funktion bezogen werden, also zum Beispiel »Der Arzt betrat das Zimmer und besah sich die Kranke« im Gegensatz zu dem obigen Beispiel. Im 19. Jahrhundert begann sich die Geschlechterordnung der Berufe langsam aufzulösen und ist heute ganz verschwunden, sodass sich offensichtlich die Sprachspiele etablierten, a) eine weibliche Variante der Bezeichnung einzuführen und sie auf konkrete Personen anzuwenden (»Die Ärztin betrat das Zimmer«) und b) die männliche Form weiter für die abstrakte Funktion zu verwenden. Der Vorwurf der feministischen Linguistik lautet ja, dass durch Letzteres die Anwesenheit von Frauen im jeweiligen Berufsfeld verdunkelt wird und man die jeweilige Tätigkeit zwangsweise weiter mit Männern assoziiert. Abgesehen davon, dass dies offenbar keine Frau davon abhält, Medizin zu studieren (aktuell sind, glaube ich, zwei Drittel aller Medizinstudenten weiblich) und wie schon beim »Schwarzfahrer« unterstellt, man könne nicht zwischen den Bedeutungen der jeweiligen Sprachspiele unterscheiden, ist eigentlich eher das Gegenteil richtig. Glauben Sie nicht? Sehen wir uns ein paar Beispiele an, die lange vor den aktuellen Sprachdebatten veröffentlicht wurden.
Dieses ist von 1935:
Dies hier wurde drei Jahre später geschrieben:
Dieses hier 1969:
Wie Ihnen sicher auffällt, sahen sich die jeweiligen Autoren genötigt, in einem Kontext, in dem »Arzt« auch in der Bedeutung der abstrakten Funktion vorkommt, in den Fällen, wo stattdessen konkrete Ärzte mit Y‑Chromosom gemeint waren, das Adjektiv »männlich« hinzuzusetzen, um den gemeinten Sachverhalt zu verdeutlichen. Das ist nicht immer so, denn ohne diesen Kontext kann »Arzt« auch durchaus nur den männlichen Mediziner bezeichnen, aber in jedem Fall ist die grammatisch feminine Form eindeutig biologisch geschlechtlich determiniert, während die grammatisch maskuline Form dies nicht mehr ist und gegebenenfalls durch ein Adjektiv näher bestimmt werden muss. Und zwar eben deshalb, weil die Autoren davon ausgehen mussten, dass das Sprachspiel »generisches Maskulinum« von den Lesern korrekt als »biologisch geschlechtslos« verstanden wird.
Was passiert stattdessen, wenn wir stattdessen das Sprachspiel »gegenderte Form« anwenden? Sehen wir uns folgenden kleinen Dialog aus einem noch nicht geschriebenen Drehbuch an:
SIE: Was ist denn passiert?
ER: Ach, nix Schlimmes. Die Kolleg*innen haben mir geholfen und mich in ein Taxi nach Hause gesetzt.
SIE (sieht sich die Bescherung an): Ja bist du denn wahnsinnig? Warum warst du denn nicht längst bei der Ärztin oder beim Arzt deswegen?
ER (kleinlaut): Das hatte ich doch schon als Student.
SIE: Und Student*innen sind ja bekannt dafür, dass sie sich wie Weltmeister*innen um ihre Gesundheit kümmern, nicht wahr?
ER: Ich mach gleich morgen einen Termin. Versprochen!
SIE: Mach dir lieber mal Gedanken, warum Männer so ein seltsames Verhältnis dazu haben, zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen!
Das Drehbuch wird natürlich ungeschrieben bleiben, aber das Ergebnis ist trotzdem klar: Die abstrakte Funktion (»Kollege«, »Arzt«, »Student«, »Weltmeister«) wird gar nicht mehr wahrgenommen, weil sich die Geschlechtsendungen in den Vordergrund drängeln und den Leser andauernd daran erinnern, dass es sowohl männliche als auch weibliche Angehörige der jeweiligen Gruppe gibt – was für das Verständnis des Gemeinten vollkommen unerheblich ist. Mit anderen Worten: Das Sprachspiel wird zerstört. Es funktioniert nicht mehr. Man kann dieser Zerstörung jetzt jeden Tag beim Anhören der verschiedenen Deutschlandradio-Programme beiwohnen, wenn man will, und eigentlich sollten sie sich dort nicht wundern, wenn man es dann eben nicht mehr will. Und sich durchaus fragt, warum man diese Zerstörung auch noch bezahlen soll.
Das mit den Männern und den Frauen
Ich mache es mir nicht leicht hier, also muss ich auch über dieses Thema sprechen. Zunächst ein paar Worte über die in diesem Fall relevante »außersprachliche Realität«: Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, mich ein bisschen intensiver mit der Kultur der Dakota- und Lakota-Sioux zu beschäftigen, nachdem ich herausgefunden hatte, dass einige meiner Urgroßtanten sich in den 1890ern in deren vorherigen Jagdgründen in Minnesota und South Dakota angesiedelt haben. Dabei war es interessant festzustellen, wie sehr das Beziehungsleben in dieser auf den ersten Blick so fremden Kultur dem unseren ähnelte: Die Teilstämme bestanden aus Gruppen von Kleinfamilien, deren zeitliche Stabilität in etwa dem entsprach, was man heute »serielle Monogamie« nennen würde, aber es gab auch lebenslange Partnerschaften, und die besten Jäger, Kriegsanführer oder Schamanen hatten schon mal mehr als eine Frau.
Unter diesen Nebenfrauen gab es gelegentlich solche, die zwar Frauenkleidung trugen und typische Frauenarbeiten wie Schneidern und Kochen ausübten, sich auch wie eine Frau gaben, aber als Männer geboren waren. Die Pelzhändler, die als erste Europäer in die Gegend kamen, bezeichneten sie mit dem französischen Wort berdache, in der Sioux-Sprache hießen sie Winkte (Lakota) oder Winkta (Dakota), was dem Vernehmen nach so viel wie »will eine Frau sein« bedeutet. Die Berichte darüber sind nicht immer eindeutig: Manchmal liest man, dass die betreffenden Personen aus ihrer Herkunftsgruppe ausgeschlossen wurden und sich als Prostituierte mit niedrigem Status einer anderen Gruppe anschließen mussten, manchmal ist aber auch davon die Rede, dass die Winkte besondere Funktionen als Heiratsvermittler und Namengeber wahrnahmen, großes Ansehen als Produzenten hochwertigen Kunsthandwerks genossen und zu den Nebenfrauen berühmter Anführer wie Sitting Bull aufsteigen konnten; vielleicht trifft beides zu. Es scheint auch Frauen gegeben zu haben, die sich dem Schneidern und Kochen verweigerten und lieber mit den Männern auf die Jagd oder in den Krieg ritten, aber offenbar kam das weniger häufig vor und führte nicht dazu, dass eine besondere Bezeichnung für sie gefunden wurde. In jedem Fall spielten in einer Gesellschaft, in der persönliche wie politische Entscheidungen oft von schamanischen Visionen unterfüttert wurden, die Traumbilder der Winkte eine wichtige Rolle, da diese als besonders empfänglich für die spirituelle Welt des »Wakan Tanka« galten. So ging zum Beispiel die siegreiche Strategie des Lakota-Führers Red Cloud in der »Schlacht der Hundert Erschlagenen« 1866 auf eine solche Vision zurück.
Wenn man den Faden weiter verfolgt, wird einem schnell klar, dass es eine ähnliche Klasse von Menschen, die sich zu dem Rollen- und Sexualverhalten des jeweils anderen Geschlechts hingezogen fühlten, in so gut wie jeder menschlichen Kultur gab. In vielen davon spielten sie eine dezidiert spirituelle Rolle, etwa bei den Schamanenreligionen Eurasiens oder den afrobrasilianischen Kulten, die Hubert Fichte so faszinierten. Auch Frauen, die mit Waffen begraben wurden, und Männer, deren Gräber typische Frauenaccessoires enthalten, finden sich in der Archäologie immer wieder. Und jeder, der mal in Thailand oder Brasilien war (oder in Hamburg in der Nähe der Schmuckstraße gewohnt hat), hat mitbekommen, dass die heutige Welt in dieser Hinsicht keine Ausnahme darstellt. Soweit ich das überblicke, ist die Ursache des Phänomens nicht wirklich bekannt, aber seine durchgängige Präsenz lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass irgendein physiologischer Vorgang dahintersteht. Vielleicht (zumindest bei den Männern) irgendwelche mütterlichen Hormone, die zu einem ungünstigen Zeitpunkt während der Schwangerschaft die Plazentaschranke überwinden? Aber eigentlich ist das egal, denn da es Transsexualismus immer gegeben hat und aller Wahrscheinlichkeit nach auch immer geben wird, ist es wesentlich wichtiger, eine vernünftige Lösung für das gesellschaftliche Miteinander zu finden.
Die westliche Kultur hatte in dieser Hinsicht keine besonders gute Ausgangsposition, da schon das Tragen der Kleider des jeweils anderen Geschlechts in der Bibel ausdrücklich verboten wird. Dies war sogar der Hauptanklagepunkt in dem Inquisitionsprozess gegen Jeanne d’Arc, und noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es in Teilen der USA entsprechende Gesetze gegen das »Cross-Dressing«. Das haben wir aber eigentlich alles hinter uns, und wenn das ganze Thema nicht momentan so ideologisch aufgeladen wäre, könnten wir uns im Grunde entspannt zurücklehnen, dem Vorbild der Sioux folgen und uns wichtigeren Fragen zuwenden. Sogar Schamanen hätten wir, sie nennen sich halt jetzt »Künstler«.
Wie Sie wissen, können wir uns nicht entspannt zurücklehnen. Das liegt daran, dass sich aus dem Paralleluniversum heraus die Ansicht verbreitet hat, dass ein Mann, der davon träumt, eine Frau zu sein, wirklich eine Frau ist. Eigentlich natürlich logisch – wenn die Realität durch Sprache erst konstruiert wird, kann man sie schließlich auch so konstruieren, dass die Kategorie »Geschlecht« nicht nur frei wählbar wird, sondern sogar frei definierbar. Man kann sich als »nicht-binär« verstehen, als »genderfluid« oder »pangender« und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind. Aber wozu führt das?
An dieser Stelle ist es nützlich, einen Hauch Übersetzungswissenschaft einzuflechten: Wie ich oben beim »Busch-Baum-Problem« schon anführte, sind Wörter nicht irgendwie naturgegeben, sondern bezeichnen Kategorien, in die wir die Welt einteilen, um darüber sprechen zu können. Eines der größten Probleme von Übersetzung besteht darin, dass jede Sprache diese Einteilung ein wenig anders vornimmt. Das ist schon bei einfachen Wörtern so, zum Beispiel bezeichnet der englische wall die deutsche Mauer, aber das englische Wort verwendet man auch, wenn man in einem ummauerten geschlossenen Bereich steht und etwa ein Bild aufhängen oder Tapeten kleistern will; im Deutschen gibt es hingegen für diesen Fall die besondere Kategorie Wand. Oder nehmen Sie Polnisch: Wenn Sie jeden Montag eine Runde im Stadtpark rennen, müssen Sie dafür das Verb biegać verwenden; wenn Sie hingegen aktuell durch den Bahnhof rennen, um ihren Zug zu kriegen, heißt es biegnąć. Keine dieser Einteilungen ist besser oder schlechter, sie funktionieren – ganz im Sinne der oben erwähnten Fuzzyness – halt alle irgendwie; in jedem Fall sind die Unterschiede in der Regel um so größer, je abstrakter die Wörter sind. Dies gilt auch für die englischen Ausdrücke sex und gender, die auf die lateinischen Wurzeln sexus und genus zurückgehen und ursprünglich beide so viel wie »biologisches Geschlecht« bedeuteten. Wie sein lateinisches Vorbild umfasste gender außerdem noch die Kategorien »Klasse« oder »Art«, was aber – wie überhaupt das ganze Wort – allmählich außer Gebrauch geriet. Im 20. Jahrhundert erlebte es dann ein Comeback, weil sex mittlerweile auch als Abkürzung von sexual intercourse interpretiert wurde und damit die etwas anzügliche Bedeutung angenommen hatte, die es heute auch als englisches Lehnwort im Deutschen aufweist. Damit könnte die Angelegenheit ihre Bewendnis haben, aber in den 1960ern fingen nun einige amerikanische Sozialwissenschaftler an, gender in der Bedeutung »soziales Geschlecht« oder »Summe der Geschlechtsrollen« zu verwenden, und so wird es dann wiederum heute als neue Entlehnung im Deutschen verstanden. Im Englischen hat das nicht ganz geklappt, dort meint man weiterhin auch das biologische Geschlecht damit (falls Sie mir nicht glauben wollen, einfach »biological gender« googeln).
Dieses terminologische Durcheinander spiegelt sich im deutschen Titel von Judith Butlers Gender Trouble wider, dem wichtigsten theoretischen Werk in diesem Bereich. Der heißt nämlich Das Unbehagen der Geschlechter, während drinnen dann dauernd von »Gender« die Rede ist. Die Frage aus linguistischer Sicht ist allerdings: Ist diese Aufspaltung in zwei Kategorien sinnvoll? Gibt es ein soziales Geschlecht überhaupt? Was damit ungefähr gemeint ist, meint man ja zunächst intuitiv zu verstehen, nehmen Sie etwa diesen Satz einer ausländischen Bekannten: »Die deutschen Männer, das sind doch keine Männer mehr!« Das erste »Männer« bezieht sich offensichtlich auf die biologische Kategorie, während mit dem zweiten eine bestimmte Rollenerwartung gemeint ist. Ist das zweite also »Gender«…? Natürlich nicht. Die Rollenerwartung ist ja nur denkbar in Bezug auf die als vorhanden vorausgesetzte biologische Kategorie – damit man von einem Mann erwarten kann, wie er sich zu verhalten hat, muss man ihn erst einmal als Mann identifiziert haben. Das Rollenverhalten der Geschlechter ist nicht weiter als das: ihr Rollenverhalten.
Auch sonst lassen sich die Wörter »Mann« und »Frau« schwer von ihrer biologischen Grundlage lösen. Sehen wir uns ein paar rasch aus dem Internet gefischte Sätze an, in denen sie vorkommen:
Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) erkranken in Deutschland jährlich etwa 4.200 Männer neu an Hodenkrebs.
Das Risiko für Gebärmutterhalskrebs hängt vor allem davon ab, ob eine Frau an der Früherkennung teilnimmt, ob sie gegen HPV geimpft ist sowie von ihrem Alter.
In Deutschland im Zeitraum 2016/18 betrug die Lebenserwartung für Männer 78,5 Jahre und für Frauen 83,3 Jahre.
Nachts in der Dunkelheit allein auf dem Heimweg: Viele Frauen haben in solchen Situationen Angst vor einer Vergewaltigung.
In Deutschland waren im Jahr 2020 rund 28 % der Führungspositionen von Frauen besetzt.
Männer leben gefährlicher und sterben früher als Frauen, das ist das Ergebnis eines Berichts des Robert-Koch-Institutes (RKI) zum Thema Männergesundheit.
Wenn Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind, heißt das Femizid.
Wie unschwer zu erkennen ist, ergibt keiner dieser Sätze einen Sinn, wenn Georgine Kellermann eine Frau ist und Elliot Page ein Mann (und nicht eine »Transfrau« und ein »Transmann«, was ja kein Problem wäre). Wie sie außerdem sehen, haben viele der angeführten Sätze einen medizinischen Hintergrund, es ist also zum Beispiel für einen Arzt bei der Diagnose von Krankheitssymptomen wichtig zu wissen, ob er einen Mann oder eine Frau vor sich hat.
Stellen Sie sich etwa einen dem Anschein nach stark übergewichtigen Menschen vor, der in einer Notaufnahme erscheint, über anhaltende Schmerzen im Unterleib klagt und sich dem Pflegepersonal gegenüber als »Mann« vorstellt. Man könnte dann annehmen, dass er vielleicht seine Blutdrucksenker nicht genommen hat, und ihn wieder nach Hause schicken, obwohl er in Wirklichkeit eine schwangere Frau ist, die gerade ihre ersten Wehen verspürt. Das Kind würde diese Fehldiagnose nicht überleben, und der schwangere »Mann« müsste sich mit einem ziemlichen Schock herumplagen. Das klingt jetzt furchtbar schlecht ausgedacht, ist es aber leider nicht: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1811491.
Man kann natürlich andere Wörter für die herkömmlichen sinnvollen Kategorien finden, etwa »Individuen mit Gebärmutterhals« (CNN im Juli 2020) für »Frau« oder die altehrwürdige feministische Schmähung »Penisträger« für »Mann«, aber damit hat man natürlich das Problem nur verschoben, denn irgendwann träumt dann eben ein Penisträger davon, ein Individuum mit Gebärmutterhals zu sein. Im Paralleluniversum hingegen haben die Wörter plötzlich wieder die Qualität Platonscher Ideen angenommen – es gibt dort offenbar irgendwo hinter den Dingen doch einen »Mann an sich« und eine »Frau an sich«, die sich unabhängig von der Biologie in den Individuen als »Identität« materialisieren können.
Aber woher sollten dann diese Identitäten kommen? Wie definiert man »Frau« und »Mann«, wenn die Definition eines Wortes der Willkür des jeweils Sprechenden bzw. dessen, der aus irgendwelchen Gründen die Definitionsmacht hat, unterliegt? Wenn wir alle nur noch der sonderbare Alte in Peter Bichsels Geschichte sind und unsere Privatsprache pflegen? Sehen wir uns zwei Hauptargumente der oben erwähnten Judith Butler an (eigene Übersetzung):
Gender steht nicht im selben Verhältnis zur Kultur wie das biologische Geschlecht zur Natur; Gender ist außerdem das diskursive/kulturelle Mittel, durch das die »geschlechtliche Natur« oder »ein natürliches Geschlecht« hergestellt und als »vordiskursiv«, der Kultur vorangehend etabliert wird, als politisch neutrale Oberfläche, auf der die Kultur sich abspielt.
Außerdem:
Gender ist eine Art von Nachahmung, für die es kein Vorbild gibt; es ist sogar eine Art von Nachahmung, die überhaupt erst eine Vorstellung des Vorbilds als Auswirkung und Folge der Nachahmung selbst hervorruft.
Mit anderen Worten: Frau Butler ist irgendwo aus der Kurve geflogen. »Frau« und »Mann« sollen ihrer Meinung nach so eine Art Münchhausen-Wörter sein, die sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf des Wortlosen gezogen und dadurch dann die Geschlechtlichkeit, die wir an der Natur wahrnehmen, erst in diese Natur hineingebracht haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich tue mich schwer damit, solchen Sätzen irgendeine Art von Sinn abzuringen. Geschweige denn, dass ich einem Transmann raten würde, sich beim Arzt auf dieser Grundlage als »Mann« vorzustellen.
Letztendlich – was ist »Identität« überhaupt? Der Duden erklärt mir, dass es sich um die »als ›Selbst‹ erlebte innere Einheit der Person« handelt, aber das kommt für meine Begriffe ein wenig arg pompös daher. Im Grunde bedeutet das Wort nichts weiter, als dass man die Kategorien akzeptiert, in die man von den anderen eingeordnet wird. Ich bin zum Beispiel Sohn einer Deutschen und eines Deutschen und im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, lebe außerdem in Deutschland, von daher würde es niemandem einfallen, mich nicht als »Deutschen« zu bezeichnen. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt – ich hätte nach Brasilien auswandern können und wäre dann jetzt ein »Deutsch-Brasilianer«, oder eines meiner Elternteile hätte aus einem anderen Land stammen können, das einen Teil auch meiner Identität abdecken würde. Schon eine Ebene weiter unten gab es in dieser Hinsicht terminologische Probleme, da mein Vater unzweifelhaft Niedersachse, meine Mutter aber in Pommern geboren und aufgewachsen war. In der Familie war nie ganz klar, ob wir Kinder nun »Pommernsachsen« oder »Niederpommern« waren, aber ganz so wichtig war es dann auch wieder nicht. Wie ich eingangs erwähnte, fühle ich mich zwischen den Stühlen ganz wohl, und unsere sprachlichen Kategorien sind eben nie so ganz in Übereinstimmung mit den Komplexitäten der Realität zu bringen.
Ähnlich ist es mit der sexuellen Orientierung. Ich bin nicht »hetero« oder »cis«, weil ich mir das irgendwie ausgesucht hätte; es treten halt beim Anblick einer Frau automatisch gewisse körperliche Reaktionen auf, die ich nicht bewusst steuern kann. In jungen Jahren war ich ein ganz hübscher Bengel, und wie das dann so ist, haben sich viele schwule Männer in mich verliebt. Meine moralische Entrüstung hielt sich in Grenzen, und ich hätte damals jede Menge Gelegenheiten gehabt, etwaige Neigungen in dieser Richtung auszuleben, aber die gewissen körperlichen Reaktionen wollten sich einfach nicht einstellen, und ich finde auch, Männer haben so etwas Eckig-Kantiges, das mich überhaupt nicht anspricht. Es würde also niemandem einfallen, mich als »schwul« oder »bisexuell« zu bezeichnen. Es ist mir sogar völlig egal, wie man mich bezeichnet und welche sexuelle »Identität« ich mir zuschreiben könnte, an meinen körperlichen Reaktionen ändert das ja keinen Deut. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand aussuchen kann, ob er sich zum Sexual- und Rollenverhalten des anderen Geschlechts hingezogen fühlt.
Etwas schwieriger ist es bei solchen Identitäten, die man nicht automatisch hat, sondern anstrebt. Ich habe mich weiter oben als »Anglist« bezeichnet; das kann ich, weil ich hier irgendwo ein Blatt Papier habe, auf dem mir die Universität Augsburg einen Studienabschluss in »Angewandter Sprachwissenschaft Anglistik« bescheinigt. In analoger Weise darf ich mich »Hispanist« und »Historiker« nennen (da ich vorher ein Vordiplom in Physik erworben hatte, könnte ich mich den Maßstäben der derzeitigen Kanzlerkandidatin der Grünen zufolge sogar als »Experte für Quantenphysik« aufspielen, aber ignorieren wir diese Frivolitäten). Der springende Punkt ist, dass ich von anderen Menschen nicht verlangen kann, mich als irgendetwas zu bezeichnen, wenn ich nicht die Voraussetzungen dafür erfülle. Wenn ich will, dass sie mich »Hirnchirurg« nennen, weil ich mich irgendwie als ein solcher fühle, bin ich keiner, sondern ein Hochstapler. Und wenn ich sie dazu zwinge, weil meine gefühlte innere Wahrheit meiner Meinung nach mehr wiegt als ihre äußere Einschätzung meiner Person, bin ich ein Hochstapler, der auch vor Nötigung nicht zurückschreckt.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum Menschen, die dem Paralleluniversum skeptisch gegenüberstehen, so aggressiv auf dessen stetig erweiterten Forderungskatalog reagieren – es geht nicht darum, das eine angeblich privilegierte Schicht sich gegen den Verlust ihrer Privilegien wehren würde; man hat einfach die ständige Nötigung satt. Vermutlich würde es gar keinen so großen Widerstand dagegen geben, die betreffenden Personen mit den Pronomina und dem Namen des gewünschten Geschlechts anzureden, aber eben die Bezeichnungen »Transfrau« und »Transmann« zu verwenden (oder irgendetwas Schöneres). Dann wüsste auch der Arzt, wen er vor sich hat. Was nervt, ist wie schon beim generischen Maskulinum die Verhinderung sinnvoller Kommunikation durch das Erzwingen offenkundigen Blödsinns. Ich hege ohnehin den Verdacht, dass die Anhänger Butlers deren Werke nicht im Hinblick auf rationale Welterklärung lesen, sondern als Sinnstiftung, wie Zen-Koans, deren Bedeutung irgendwo in ihrer offenkundigen Paradoxität verborgen liegt.
*
Wenn das alles so absurd ist – wie kommt man dann darauf? Und warum ist mir das alles so fremd …? In meiner Jugend pflegte man auf solche Fragen mit »Hab ich Latschen an den Füßen?« oder »Hab ich Löcher in den Händen?« zu antworten, ich versuche es trotzdem mal. Gehen wir zu diesem Zweck zurück zu der eingangs erwähnten Weide, die das derzeitige Einsatzgebiet unseres Rasenmäherteams darstellt:
Es handelt sich dabei um Athos und Porthos (Aramis ist leider an einer Wurminfektion verstorben) sowie Castor und Pollux (die mit dem hellen Fell). Die vier unermüdlichen Grasvertilger gehören einer französischen Zwergschafrasse an, die von der Île de Ouessant stammt, und da wir uns keine Lämmeraufzucht ans Bein binden wollten, haben wir ausschließlich Böcke angeschafft. Wir haben sie von unserer Tierärztin kastrieren lassen, damit sie nicht ganz so wild sind, aber sie sind eigentlich immer noch wild genug. Zum Beispiel lassen Athos und Pollux auf dem Bild gerade die Köpfe aneinanderkrachen, weil sie sich um den Rest von dem Quetschhafer streiten, den ich den vieren hingestellt habe. Sie machen das oft auch ohne Quetschhafer, einfach nur um herauszufinden, wer von ihnen der Stärkste ist. Haben Sie schon mal gehört, wie der Kopf eines Ouessant-Bocks frontal auf den seines Kontrahenten prallt? Eigentlich müssten beide danach eine schwere Gehirnerschütterung davontragen, aber diese Burschen sind wirklich zäh.
Auf dem Weg zurück ins Haus kommen wir am Hühnerstall vorbei. Wir haben seine jetzigen, aus England stammenden Bewohner von einer Bekannten bekommen, ich glaube, die Rasse ist eine Mischung aus Hamburgern und Austral Orbs. Jedenfalls brüten sie manchmal ihre Eier selbst aus, und wir hatten schon Jahre, in denen wir fünfzehn Stück großbekommen haben und dann schlachten konnten (ich hoffe, ihr Entsetzen hält sich in Grenzen). Dieses Jahr hatten wir Pech, von vielen Eiern ist nur ein einziges Küken geschlüpft, das jetzt auch schon ziemlich groß ist und mit den anderen Hühnern auf der Stange sitzt:
Das Küken ist ganz schön frech, kommt immer gleich als Erstes, wenn es etwas zu fressen gibt, und futtert den anderen weg, was es kann. Es hat auch Probleme, sich in die Hackordnung einzufügen, die von einem Hahn angeführt wird, der seine Damen den Tag über auf dem Hühnerhof herumführt. Das Küken hingegen sitzt viel alleine herum, wie in der Pubertät so üblich. An den relativ langen Beinen kann man jetzt schon erkennen, dass es ein junger Hahn ist.
Vorlaut und unhöflich ist übrigens auch die weißorange Katze, die Sie im nächsten Bild sehen. Wenn man statt zweier nur eine Schüssel mit Katzenfutter hinstellt, drängelt sie unsere zweite Katze zur Seite und stürzt sich rücksichtslos darauf, während ihre Kollegin traurig danebensteht und nicht weiß, was sie machen soll:
Auch hier gilt: ganz typisch für Männer, denen niemand Manieren beigebracht hat, denn die schwarzweiße Katze ist natürlich ein Weibchen, während die weißorange ein Kater ist. Er heißt »Einstein«, und wenn er nicht gerade mit Fressen und Schlafen beschäftigt ist, stellt er Experimente mit der Schwerkraft an, indem er Teller zu Boden schmeißt, die darauf warten, in die Spülmaschine zu kommen.
Wie Sie sehen, haben wir schon ein paar Tiere hier, aber das ist wirklich nur ein schwacher Abglanz der Welt, in der ich aufgewachsen bin. In der Landwirtschaft alten Schlages, in der alle Landwirte gleichzeitig Viehhalter und Ackerbauern waren, war man noch tagtäglich mit allen möglichen Aspekten des Verhaltens unserer mehr oder weniger weit entfernten Verwandten auf den benachbarten Zweigen des evolutionären Stammbaums konfrontiert. Tiere wurden geboren, wuchsen auf, kopulierten, bekamen selbst Nachwuchs und wurden entweder geschlachtet oder starben an Krankheiten und Altersschwäche. Und die Männchen und Weibchen benahmen sich in der Regel so erkennbar unterschiedlich, dass die Einordnung in Geschlechtskategorien kein Zaubertrick einer »nicht nachahmenden Nachahmung« war, sondern sich einfach von selbst aufdrängte. Wenn unter den Schweinen, die ich auf die Weide bringen musste, ein Eber war, übernahm mein Vater selbst diese Aufgabe, denn er hatte Angst, dass mir etwas passieren könnte. Das galt auch für den Fall, dass wir Kinder am Fluss spielen wollten und dazu eine Kuhweide überqueren mussten – solange nur Kühe und Kälber darauf standen, war das kein Problem; die Anwesenheit von Bullen hätte es zum Selbstmordkommando gemacht.
Auch der Anbau von Feldfrüchten brachte es mit sich, dass man bestimmte Erfahrungen machte. Zunächst einmal die, dass man etwas, dass man essen will, gegen die Begierden der anderen Tiere und jener Pflanzen, die auch auf dem Acker wachsen möchten, verteidigen muss. Und wenn man dafür keine chemischen oder maschinellen Mittel einsetzen kann (zum Beispiel beim Rübenhacken), dann ist das eine verdammt anstrengende körperliche Arbeit. Man lernte außerdem, dass man noch so schlau sein und sich noch so sehr anstrengen kann, aber trotzdem keinen großen Einfluss auf den Ernteerfolg hat, weil es zufällig nicht genug geregnet hat. Diese Welt funktionierte nach ihren eigenen Regeln, und sie redete in einer Sprache mit uns, die älter ist als Worte. Man konnte sie nicht intellektuell verstehen, sondern nur mit allen Sinnen erfahren, und verglichen damit ist die postmoderne Philosophie nur ein Daunenfederchen im Sommerwind.
An dieser Stelle müssen wir kurz zu Wittgenstein zurückkehren, diesmal um ihm eine seiner anderen Thesen aus dem Tractatus um die Ohren zu hauen. Er schreibt dort:
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Der österreichisch-britische Philosoph hat viele bemerkenswerte und kluge Dinge geschrieben, die einem das Verständnis der Welt erleichtern können; mit diesem Satz hingegen hat er sich auf ewig in die Top-Ten des größten philosophischen Blödsinns eingeschrieben. Selbstverständlich gehen die Grenzen meiner Welt weit über die Sprache hinaus, denn noch vor jedem Wort erschließe ich mir diese Welt dadurch, dass ich sie begreife, eine Anschauung von ihr gewinne, etwas nicht riechen kann, das Gras wachsen höre, auf den Geschmack komme, mich an ihr abarbeite, physische Widerstände überwinde, mich dem Stärkeren beugen muss und so weiter und so fort. Diese nonverbalen Möglichkeiten der Welterfahrung, ebenso wie die Emotionen, die Angst vor einer Gefahr oder die Freude über ein Gelingen, spielen sich auf einer mehr oder weniger unbewussten und bildhaften Ebene weit unterhalb des Intellekts ab, und sie sind eines der Korrelate, die man braucht, um entscheiden zu können, ob Sprache die Wirklichkeit korrekt abbildet oder nicht. Ein anderes wäre der Ansatz, den ich oben kurz angerissen und Karl Popper entlehnt habe: Nicht nur Wörter sind Hypothesen über die Wirklichkeit, auch unsere Handlungen sind es. Manchmal werden sie falsifiziert, dann bleiben in der Regel Narben zurück, manchmal können sie sich aber auch behaupten. Die Summe aus all dem ist ein Weltwissen, dessen man sich halbwegs sicher sein kann, gerade weil es nicht auf Sprache beruht.
Es fällt auf, dass eine so eminent praktische Philosophie wie diejenige Poppers von jemandem erdacht wurde, der schon als Schüler seinen Lebensunterhalt nebenher als Hilfsarbeiter verdiente und später eine Tischlerlehre absolvierte. Viele der Kandidaten hingegen, die sich um einen Platz auf der oben erwähnten Top-Ten balgen, stammten aus schwerreichen Fabrikanten- und Kaufmannsfamilien und waren dadurch den materiellen Sorgen und Nöten der realen Welt schon zu ihrer Zeit so weit entwachsen, wie dies heute für weite Teile der Gesamtbevölkerung gilt. In den reichen Ländern des Westens wachsen seit mehreren Generationen die meisten Kinder nicht mehr in der direkten sinnlichen Erfahrung der Welt, sondern vor dem Fernseher auf, und man kann wohl kaum sagen, dass sich das Problem durch die seit zehn, zwanzig Jahren immer länger werdenden Aufenthalte in den virtuellen Räumen des Internets und der Computerspiele irgendwie entschärft hätte. Muss man sich also wundern, wenn immer mehr Leute glauben, wir Menschen würden uns unsere eigene Welt erschaffen, die ausschließlich nach unseren eigenen Regeln funktioniert?
Es gibt sicher noch weitere Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. So mag man es der verbreiteten Kinderlosigkeit zuschreiben, dass der Zusammenhang des Wortes »Geschlecht« mit der Zeugung (und nur in diesem Kontext hat das Wort überhaupt einen Sinn) für viele offenbar verloren gegangen ist. Auch die Tatsache, dass wir uns ungern als Tier unter Tieren sehen, weil wir uns dann unserer biologischen Bedingtheit (und vor allem Sterblichkeit) stellen müssten, wird nicht ohne Einfluss bleiben. Wesentlich wichtiger scheint mir allerdings etwas, das man als »Verschmelzung der Postmoderne mit der radikalen Linken« bezeichnen könnte. In einem früheren Beitrag habe ich mich mal darüber ausgelassen, was es bedeutet, »links« zu sein, hier eine kondensierte Fassung: Man ist links, wenn man
-
die Welt am Ideal von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit misst und versucht, die ermittelte Diskrepanz möglichst zum Verschwinden zu bringen;
-
dies (zumindest vorgeblich) nicht im eigenen Interesse tut, sondern im Namen derer, die von den herrschenden Verhältnissen am meisten benachteiligt werden.
Vor allem im Hinblick auf den zweiten Punkt stand die radikale, vor allem akademische Linke in den 1980ern vor einem handfesten Problem. Ich habe in dem erwähnten Beitrag ja von den Arzt- und Lehrerkindern erzählt, die meinem Vater in der Fußgängerzone der nächsten Kleinstadt 10 Jahre zuvor maoistische Pamphlete in die Hand drücken wollten (was der sich als standfestes Gewerkschaftsmitglied und SPD-Wähler natürlich verbat). Diese Possen gingen bekanntermaßen auf die damals geläufige orthodox-marxistische Geschichtsdeutung zurück, die in der »Arbeiterklasse« jene Kraft erblickte, mit deren Hilfe man den ehernen Gesetzen des dialektischen Materialismus zufolge das Ende der herrschenden imperialistisch-ausbeuterischen Gesellschaftsordnung einläuten würde.
Nicht nur mein Vater, auch der Großteil der anderen Arbeiter hustete ihnen was, und als dann auch noch die Mauer fiel und der Linken all die Leute von der Fahne gingen, die man vier Jahrzehnte lang vergeblich versucht hatte, zur »sozialistischen Persönlichkeit« zu erziehen, war offenbar die Zeit gekommen, sich nach anderen Benachteiligten umzusehen, deren Interessen man vertreten konnte. Ungefähr zu dieser Zeit fingen die Namen französischer Philosophen an, durch die Seiten der taz zu geistern, erst nur ganz selten, dann immer häufiger, und Begriffe wie »Vielheit«, »Différance« und »Dekonstruktion« ließen den Leser rätseln, was wohl damit gemeint sein könnte. Auch an der Uni konnte man die entsprechenden Theorien nicht mehr ignorieren. Die meisten meiner Professoren waren noch entweder bürgerlich-liberal oder klassisch links eingestellt, aber die Betreuerin meiner Magisterarbeit hatte es von der Sorbonne und aus Stanford an den Lech geweht, und sie traktierte uns in den Hauptseminaren mit zentnerschweren Readern, in denen neben diversen etwas traditionelleren linken Gedankengebäuden auch die postmodernen Philosophen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten. Schon damals gab es historische Aufsätze, die allen Ernstes die These aufstellten, die strenge Teilung der indischen Gesellschaft in separate Kasten sei in Wirklichkeit eine Erfindung der Briten, die auf diese Weise ihre »orientalistische« Sichtweise den eigentlich total toleranten Indern aufgezwungen hätten, und ein britischer Historiker konnte mit viel Medienaufmerksamkeit behaupten, das klassische Griechenland sei eine koloniale Gründung der Phönizier und Ägypter gewesen, was man nur aufgrund des Rassismus der europäischen klassischen Altertumswissenschaftler übersehen hätte (dank der genetischen Revolution ist mittlerweile beides geräuschlos in der Versenkung verschwunden). Als mir die Professorin in der mündlichen Prüfung eine Note abzog, weil ich nicht mehr so ganz genau wusste, was irgendeine alberne, in den 1970ern beliebte anti-imperialistische Theorie beinhaltete, ich weiß nicht mehr, ob es Wallersteins Weltsystem oder die Dependenztheorie war, wurde mir klar, dass meine berufliche Zukunft nicht an der Universität liegen konnte.
Die Kommilitonen, denen die dicken Reader gefielen, sahen das natürlich anders, und die haben halt jetzt die Lehrstühle inne. Während sie noch an ihren Karrieren bastelten, formierte sich auf der Linken langsam, aber sicher etwas heraus, das ich mal »Neuer Konsens« nennen möchte. Er besteht zu einen in der Verachtung der alten Arbeiterklasse – vermutlich zu einem guten Teil aus enttäuschter Liebe, aber der Umstand, dass man seinem bürgerlichen Snobismus den Unterschichten gegenüber endlich freien Lauf lassen konnte, wird seine Rolle gespielt haben. Zum anderen ging es um die Schaffung eines neuen revolutionären Subjektes, das nun aus einer breiten Koalition von Minderheiten besteht, die angeblich von der dominanten Mehrheit daran gehindert werden, ihre »differente« Wahrheit frei ausleben zu können. In diesem Sinne muss man wohl beispielsweise die Selbstbezeichnung von BLM-Aktivisten als »Marxisten« oder den neurechten Kampfbegriff »Kulturmarxismus« verstehen, denn eigentlich könnte die im Neuen Konsens vereinte postmoderne Linke kaum weiter von den Theorien Karl Marx’ entfernt sein. Ging es dort noch um angeblich objektiv in der Geschichte wirkende Mechanismen und Gesetze, basiert die »vorgestellte Gemeinschaft« (Benedict Anderson) der LGBTQIA+ und BIPOC ausschließlich auf den Gefühlen der Menschen, die ihr angehören wollen. Verbindendes Element ist höchstens noch der utopische Fluchtpunkt, von einer Märchenwelt zu träumen, in der es keinerlei Einschränkungen des menschlichen Willens mehr gibt.
Der Neue Konsens hat viele Vorteile, so mussten die K‑Grüppler in den 1970ern sich noch zu Lesekreisen zusammenschließen, in denen »Das Kapital« und Maos kleines rotes Buch gemeinsam durchgeackert wurden, um die durchaus anspruchsvolle Ideologie zu verstehen. Das theoretische Grundkonzept des Neuen Konsenses hingegen begreift jeder, der mal eine Vorstellung von »Kasperle und das Krokodil« gesehen hat: Es gibt böse Menschen, die die Macht haben und sie nutzen, um gute Menschen zu unterdrücken, die einfach nur nach ihren eigenen Maßstäben leben wollen. Es dürfte dieser simple Moralismus sein, der dem Paralleluniversum zu seinem ansonsten ganz unverständlichen Siegeszug verholfen hat – nicht mal der CDU wählende Kirchenvorstand möchte noch in den Verdacht kommen, auf der Seite des Krokodils zu stehen und anderen Menschen sagen zu müssen, dass man nicht alles sein kann, was man will.
Konsequenterweise kommt der Widerstand dagegen auch kaum aus dieser Ecke, sondern eher von klassischen Linksliberalen und den mittlerweile als »TERFs« verschrienen Feministinnen alten Schlages, die begriffen haben, dass Frauenförderprogramme sinnlos sind, wenn sich jedermann problemlos selbst zur Frau ernennen kann. Aber sie haben einen schweren Stand, denn wenn nicht nur das Geschlecht, sondern die ganze Realität frei konstruierbar ist, bleibt die Moral als einziges Kriterium übrig, um die Handlungen eines anderen Menschen zu beurteilen. Dann können sogar Transfrauen böse auf lesbische Frauen sein, die keine Lust haben, mit ihnen zu schlafen, denn dies bedeutet ja, dass Letztere willentlich ihre Realität so konstruieren, dass sie darauf keine Lust haben, obwohl sie doch sonst behaupten, auf Frauen zu stehen. Klingt schräg, ist aber die logische Folge der Grundannahme. In Fragen der Moral kennt der Mensch keinen Spaß, und das ist sicher auch der Grund, warum es den Bewohnern des Paralleluniversums egal ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihre Positionen ablehnt – wer sich im Besitz der überlegenen Moral glaubt, für den ist eine solche Ablehnung keine zulässige Meinung, sondern der erste Stein auf dem Weg in die Hölle von Faschismus und Imperialismus.
Dazu kommt eine Funktion von »Identität«, die ich oben nicht erwähnt habe – wir sind soziale Tiere und identifizieren uns über Symbole, Weltanschauungen oder Religionen mit irgendeiner Gruppe, der wir uns zugehörig fühlen. Das ist wahrscheinlich der psychische Mechanismus, der es uns ermöglicht, in riesigen Gesellschaften zusammenzuleben, die weit über die paar Dutzend Individuen hinausgehen, zu denen sich unsere Primatenverwandten zusammenfinden. Religion spielt hierbei offenbar die wichtigste Rolle, und die grundlegende Großgesellschaft, die man auf allen Kontinenten und zu allen Zeiten findet, ist die des sakralen Königtums, bei der eine »gesalbte« Herrscherfigur irgendwie religiös legitimiert erscheint, über ihr Reich zu herrschen. Unsere Zeit wirkt auf den ersten Blick areligiös, aber was wäre die Ideologie des Paralleluniversums anders als eine neue Glaubenslehre, nicht weniger absurd als Jungfrauengeburt oder Auferstehung der Toten, und von manchen ebenso glühend geglaubt?
Auch die Existenz eines Feindes, gegen den man zusammenstehen muss, scheint von wichtiger Bedeutung für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft zu sein. Denken Sie zurück an den Kalten Krieg in der Bundesrepublik – die bloße Existenz von Sowjetunion und DDR gewährleistete, dass die Linke sich mit Enteignungsphantasien zurückhielt (man sah ja, wohin das führte) und die Rechte zähneknirschend den Sozialstaat akzeptierte (man konnte ja nie wissen, wen die Arbeiter sonst wählen würden). Dreißig Jahre später hingegen sehen wir den Westen vor unseren Augen zerfallen, und es sind verschiedene Lager entstanden, die sich gegenseitig als »Nazis« und »Woke« beschimpfen und die Pest an den Hals wünschen. In diesem Kontext sind die neuen Sprachregeln weniger eine praktisch verwendbare Kommunikationsform als ein Shibboleth, durch dessen Verwendung man zu erkennen gibt, zu welcher Gruppe man gehört.
In dieser Hinsicht ist wohl auch das um sich greifende Gendern in den Medien zu verstehen: Man zeigt unüberhörbar, dass man einer von den Guten ist – ganz wie früher die bigotten Bürgersfrauen, die darum wetteiferten, ihre Mildtätigkeiten so öffentlich wie möglich darzubieten. Und auch für das Geschäft ist es nicht schlecht, denn da die postmoderne Linke nicht mehr die Interessen der Arbeiter vertritt, ist es für die international agierenden Konzerne eine offenbar unwiderstehliche Versuchung, sich die Positionen des Neuen Konsenses zu eigen zu machen, denn a) verkauft sich Moral immer gut und b) hat man damit wie durch Zauberhand ein neues Disziplinierungsinstrument in der Hand, mit dem man sein Personal in Angst und Schrecken versetzen kann. Arbeiter sind, glauben Sie’s einem Arbeitersohn, in der Regel das, was man heute »sozial konservativ« nennt und damit vom Paralleluniversum aus schwer erreichbar. Umso besser für die Bosse, wenn ihre Belegschaft deswegen stets in Gefahr schwebt, gegen die neuen, alle Geschlechter und Identitäten mitnehmenden Firmenrichtlinien zu verstoßen … Auf Dauer wird das keine besonders positiven Auswirkungen auf die Produktivität haben, aber das war im real existierenden Sozialismus auch nicht anders, und es hat nur dazu geführt, dass die dort tonangebenden Führungsschichten mit noch mehr Elan weiter gegen die gleiche Wand gelaufen sind. Und wie die naturwissenschaftliche Kompetenz zukünftiger Physiker sich entwickelt, wenn sie einen Teil ihres Studiums darauf verschwenden müssen, über die rassistischen Implikationen des Begriffes »Schwarzes Loch« zu sinnieren (ich erspare mir den Link, Sie haben sicher davon gehört), werden wir auch erst in zwanzig Jahren wissen. Aber dann, wenn Sie mir das Wortspiel verzeihen, werden mit Sicherheit längst ganz andere Säue durchs Dorf getrieben.
Man vergleicht unsere Zeit ja gerne mit wahlweise dem untergehenden Römischen Reich oder dem Ende der Römischen Republik; ich fühle mich eher an die Kinderbrigaden Savonarolas und die Zeit zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg erinnert. Die alten Linksliberalen spielen die Rolle von Lutheranern und Calvinisten, die zunächst erfolgreich den Weg zur Macht fanden, dann aber einerseits von der katholischen Reaktion, andererseits von Wiedertäufern, Puritanern und Rosenkreuzern herausgefordert wurden, denen die Reformation noch nicht reformiert genug war. Wer deren Rolle heute spielt, brauche ich wohl nicht zu erläutern. Sorgen bereitet mir außerdem das jetzige Pendant zur katholischen Kirche, denn während diese damals noch auf die Jesuiten zurückgreifen und sich selbst einer gründlichen Reform unterziehen konnte, sind die heutigen Konservativen – von Einzelkämpfern wie Roger Scruton einmal abgesehen – in einem intellektuell derart jämmerlichen Zustand, dass aus dieser Richtung keine größeren Impulse zu erwarten sind.
Die meisten von ihnen glauben wahrscheinlich immer noch an die gottgegebenen »Dinge an sich« und trauen sich nur nicht mehr, das auch öffentlich zu vertreten. Wie wir gesehen haben, ist das auch gar nicht das Problem, sondern vielmehr, dass die neuen Sprachregelungen eine sinnvolle Kommunikation verhindern. Die Liberalen hingegen sind lange der Selbsttäuschung erlegen, das Ganze als Blödsinn abzutun, der sich demnächst aufgrund seiner offenkundigen Irrsinnigkeit von alleine erledigen wird – ein Fehler, dessen ich mich wie oben schon angedeutet auch selbst bezichtigen muss. Leider wissen wir aus der Geschichte, dass auch offenkundiger Irrsinn manchmal ziemlich lange braucht, um wieder aus den Köpfen der Menschen zu verschwinden. Die europäischen Konfessionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts sind im Grunde erst seit ein paar Jahrzehnten vorbei, genauer gesagt, seitdem gemischt konfessionelle Ehen kein größerer Stein des Anstoßes mehr sind. Und um die seit den Ende des 19. Jahrhunderts in vielen Köpfen spukende Interpretation der Geschichte als »Rassenkampf« wieder loszuwerden, musste es erst einen Weltkrieg geben, in dem Imperien untergingen, Völker ihre Freiheit verloren und ein ganzer Kontinent in Schutt und Asche versank.
*
Kann man das noch verhindern? Ich weiß es nicht. Ich werde auch weiterhin politisch zwischen allen Stühlen bleiben, aber wenn es keine gemeinsame, von allen geteilte Realität mehr gibt, auf deren Grundlage eine politische Debatte überhaupt erst möglich ist, bleibt mir nur noch die Rolle des komischen Alten, der weiter seine komische altmodische Sprache verwendet und auch sonst irgendwie nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Ganz ehrlich – so alt fühle ich mich noch gar nicht. Und die Scheiße schwappt jeden Tag ein bisschen höher an die Mauern meines Elfenbeinturms. Die Rassenfrage ist offenbar nicht totzukriegen und wurde gerade wieder in den Spielplan des Kasperletheaters aufgenommen, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen, sodass man als »Weißer« jetzt zwar immer noch eine Sonderrolle spielt (Puh, Gottseidank…), aber nun eben diejenige, unheilbar böse zu sein. Viele Angehörige des Bildungsbürgertums haben auf die neuen gesellschaftlichen Zwänge reagiert wie meine Vorfahren auf das Ende der kollektiven Landbewirtschaftung: sie haben sich angepasst. Statt Schweine zu halten, sind sie allerdings ins Paralleluniversum umgezogen und akzeptieren die dortige Hausordnung als neuen Standard, jenseits dessen nur noch die Welt des Krokodils wartet. Ein Freund, der in der Verwaltung einer Großstadt arbeitet, berichtet uns von Arbeitskonferenzen, in denen jeder der Teilnehmer peinlich bemüht ist, ja keinen Gender-Schluckauf zu verpassen. In den ersten Bundesländern werden Überlegungen angestellt, wie man auch im Grundschulunterricht gegenderte Sprache einführen kann. Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm eine »Veränderung des Gesundheitssystems hin zu einer medizinisch-therapeutischen Behandlung und Betreuung [sic] die ohne geschlechtliche Deutung auskommt«. In den angelsächsischen Ländern, uns wie immer um ein paar Nasenlängen voraus, kann man sich mitunter schon strafbar machen, wenn man das gefühlte Geschlecht eines anderen nicht durch die korrekte Anrede honoriert, und Prominente, die öffentlich bekunden, an der herkömmlichen Bedeutung der Wörter »Mann« und »Frau« festhalten zu wollen, sind über Nacht keine Prominenten mehr. In ein paar Jahren wird man schief angeguckt werden, wenn man noch Deutsch redet und schreibt, wie man es gewohnt ist, und die Jüngeren werden orientierungslos zwischen den Trümmern einer halb abgeräumten Tradition, einer in der Öffentlichkeit erforderlichen Unsprache und dem gewöhnlichen »Zuhause-Deutsch« hin und her irren. Und da fragen Sie sich wirklich, warum ich Angst habe, meine Sprache zu verlieren?
Die Chance, diese Entwicklungen wieder rückgängig zu machen, sind wohl kurzfristig eher gering. Ich verrate Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich Ihnen die traurige Mitteilung mache, dass in der industrialisierten Landwirtschaft von heute nicht einmal mehr die Bauernkinder zusammen mit Nutztieren aufwachsen. Und ihre Mütter haben auch keine Bauerngärten mehr, in denen sie lernen könnten, dass der Anbau von Nahrungsmitteln eine ziemlich anstrengende und notwendigerweise gegen die Natur gerichtete Arbeit ist. Stattdessen sitzen lauter verwirrte Zwanzigjährige vor einer Kamera und streamen ihre Idee von sich selbst in die Welt hinaus. Im Grunde bräuchte es einen verbindlichen »Realitätsdienst« für alle, ein unfreiwilliges ökologisch-sozial-militärisches Jahr, das sämtliche Geschlechter damit verbringen müssten, beim Biobauern Unkraut zu hacken, Bettlägerigen im Altenheim die Windeln zu wechseln oder für das Vaterland im Schlamm der Lüneburger Heide herumzukriechen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich fordert mal wieder nur die AfD so etwas, und wenn das Krokodil irgendetwas fordert, ist es selbstverständlich höchst verdammenswürdig und kommt nicht mal in die Nähe einer ernsthaften Diskussion. Dabei ist die Sprache nicht der einzige Bereich, in denen unsere herrschenden Schichten den Kontakt zur Realität verloren haben. In Afghanistan versinkt gerade der jüngste Versuch des Westens, eine liberale Demokratie aus der Retorte zu schaffen, im Chaos und der erneuten Machtübernahme des religiösen Obskurantismus. Und während wir uns hier um Dragqueens im Kindergarten streiten, hängen wir bei der Produktion kritisch wichtiger technischer Infrastruktur mittlerweile derart heillos von China ab, dass wir uns gar nicht mehr trauen dürfen, dort noch groß wegen Menschenrechtsfragen aufzutrumpfen. Wir hätten ein wenig Realitätssinn bitter nötig.