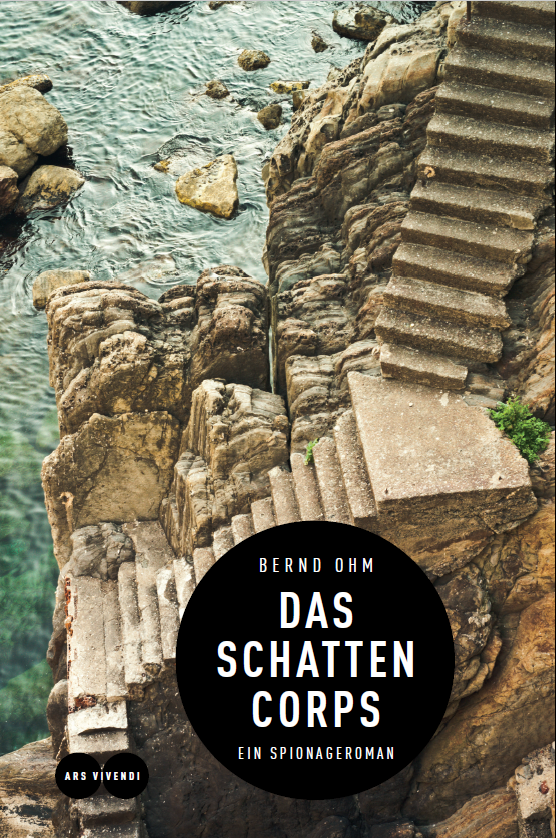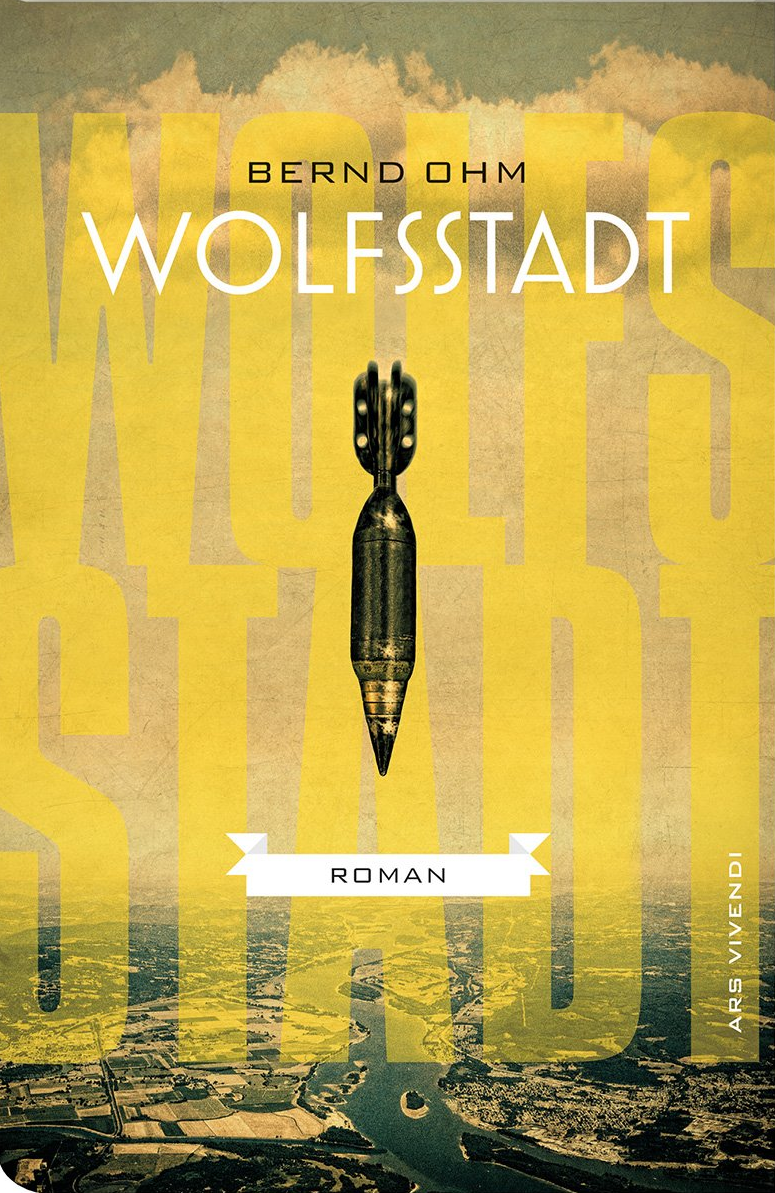Immer diese Kinderfragen … Jetzt wollte mein Sohn wissen, warum junge Leute eigentlich meistens »links« sind. Ich musste natürlich sofort an den wahlweise Winston Churchill oder Bertrand Russell zugeschriebenen Spruch denken, nach dem man kein Herz hat, wenn man mit zwanzig kein Sozialist ist, aber keinen Verstand, wenn man dieser Weltanschauung mit vierzig immer noch anhängt. Meine Frau hingegen erinnerte mich süffisant grinsend an mein altes Che-Guevara-T-Shirt, das ich vor etlichen Jahren bei den Bauarbeiten hier aufgetragen habe. Tatsächlich kann ich nicht völlig leugnen, in meiner Jugend bis zu einem gewissen Grad dem damals weit verbreiteten Aberglauben angehangen zu sein, man müsse das, was hinter dem Eisernen Vorhang so krachend und offensichtlich gescheitert war, unter dem Vorzeichen von Ökologie, Anti-Dogmatismus und Jimi Hendrix nochmal ganz neu in Angriff nehmen.
Aber warum? Beziehungsweise, warum glaube ich das jetzt nicht mehr …? Vielleicht spielt ja jugendlicher Übermut eine Rolle, revolutionäre Begeisterung, die Hormone und so weiter. Die verstrahlten Typen, die letzten Sommer beim G20-Gipfel in Hamburg Barrikadenkampf gespielt haben, schienen voll davon zu sein. Aber das sind bestimmt auch »Hooligans gegen Salafismus« oder »Salafisten gegen ungläubige Hunde«. Das ganze zwanzigste Jahrhundert war ja eigentlich eine einzige Geisterbahn, in der hinter jeder Kurve eine neue, wütende Jugendbewegung hervorgesprungen kam, egal unter welcher Flagge. Hormone sind, wie mir scheint, weltanschauungsmäßig flexibel.
Viel eher geht es um die Kraft des reinen Herzens. Als zwanzigjähriger Student kann man in der Regel auf volle zwei Jahrzehnte zurückblicken, in denen der eigene Beitrag zum Lebensunterhalt ebenso bescheiden ausgefallen ist wie die persönliche Mitwirkung an der Steuerung des Gemeinwesens, zu dem man gehört. Das verführt dann beispielsweise dazu, »Reichtum« als etwas zu betrachten, das irgendwie auf übernatürliche Weise von selbst da sei und nur »gerecht verteilt« werden müsse – so wie die Geschwisterschar die gerechte Verteilung des Taschengelds von den Eltern einfordert. Und die Politik gerät zum Kasperletheater, in dem das böse, gierige Krokodil besiegt werden muss, das – als Politiker, Banker oder Arbeitgeberpräsident getarnt – der gerechten Verteilung im Wege steht.
Etwas pompöser ausgedrückt: Man sieht die Welt vor allem im Ideal gespiegelt. Und sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht wunderbare Ideale? Ganz zu schweigen von Vernunft, Humanität und Gerechtigkeit …! Wenn man jung ist, liebt man Ideale. Sie erlauben es einem, in die Heldenrolle zu schlüpfen, in der man sich in diesem Lebensalter gerne sieht – nicht zuletzt wegen der, ähem, vorteilhaften Wirkung auf das andere Geschlecht natürlich. Man stürmt in die Welt hinein im Vollgefühl der eigenen Rechtschaffenheit und sucht überall nach Drachen, die man besiegen kann. Und selbstverständlich kämpft man nicht aus Egoismus, sondern dafür, arme, unterdrückte Proletarier/Drittweltbewohner/Minderheiten, die aus irgendwelchen geheimnisvollen Gründen nicht in der Lage sind, selbst für ihre Interessen einzutreten, aus den Klauen der Bestie zu befreien …
Wenn man Glück hat, nimmt einen das Leben später sanft bei der Hand und zeigt einem anhand ausgewählter Beispiele, dass vor dem Reichtum meistens ein Riesenhaufen Arbeit steht, statt eines glänzenden Sieges häufig nur das kleinere Übel zur Wahl steht und das Gegenteil einer schlechten Idee meist eine noch schlechtere ist. Wenn man Pech hat, haben ein oder zwei größere persönliche Katastrophen exakt die gleiche Wirkung. Das Ergebnis ist – hoffentlich – eine gewisse Nüchternheit und Skepsis sowie die Erkenntnis, dass andere Leute ihre Bedürfnisse meist ganz gut selbst artikulieren können und jedes Ideal, das man bis in die letzte Konsequenz zu verwirklichen sucht, mit ziemlicher Sicherheit geradewegs in die totalitäre Hölle führt. Gleichheit etwa ist eine tolle Sache, wenn es darum geht, dass vor dem Gesetz niemand bevorzugt wird. Wenn man allerdings weitergeht und fordert, dass jeder Mensch tatsächlich gleich sein soll (obwohl doch jeder von uns eine eigene Welt ist), endet man aller Erfahrung nach in der Gleichheit des sibirischen Arbeitslagers.
Aber das weiß man natürlich noch nicht, wenn man seine Nase zum ersten Mal aus der Tür der Kindheit heraussteckt. Ich glaube, ich war vierzehn oder fünfzehn, als ich spontan in der Buchhandlung der nächsten Kleinstadt ein Taschenbuch mit den Werken von Marx und Engels erwarb und von vorne bis hinten durchlas – ohne groß zu begreifen, um was es ging, versteht sich. Aber es kam der Satz darin vor, dass Religion das »Opium des Volkes« sei, und das gefiel mir, hatte ich doch gerade im Verlauf des Konfirmandenunterrichts unversehens meinen Glauben verloren. Irgend so ein alter Knacker mit Bart, der in den Wolken sitzt? Was wollte der denn …
Womit ein weiterer Faktor für die Beliebtheit sozialistischer Vorstellungen bei der Jugend angesprochen ist. Sie gleichen vage bestimmten christlichen Werten, ohne dass man dafür an übernatürliche Wesen glauben muss. Und es ist genauso unmöglich, sie eins zu eins in die Realität umzusetzen: Rein theoretisch klingt es ja absolut großartig, die andere Wange hinzuhalten und seinen Mantel mit einem Bettler zu teilen. Man sieht sich schon höchstpersönlich selbst auf dem Pferd sitzen und dem armen Hund da unten am Boden voll Mitgefühl die halbe Toga reichen … Im Alltag läuft es dann allerdings ein bisschen anders – welcher Unternehmer etwa könnte sich stets an Matth. 5, 40 halten (»Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel«), ohne mittelfristig Bankrott erklären zu müssen? Man gibt also ab und zu ein kleines Stückchen Mantel ab und hofft, dass man dadurch das Kamel doch noch irgendwie durchs Nadelöhr zwängt. So, wie man für die Revolution kämpft, ohne auf teure Zigarren und Rolex-Uhren zu verzichten.
Und dann gibt es natürlich immer die Verlockung, in die Haut des romantischen Helden zu schlüpfen, der wie der Wanderer über dem Nebelmeer allem Irdischen entsagt und sich ganz der Sache des Volkes verschreibt … Das letzte Mal, als ich so richtig Sympathien für eine linke Bewegung empfand, war in den 1990ern, als ein gewisser »Subcomandante Marcos« mit einer Kiste Bücher aus Mexiko-Stadt in den lakandonischen Urwald zog, um unter dem Schlachtruf »Alles für alle, nichts für uns!« für die Rechte der Indigenen zu kämpfen und »Intergalaktische Treffen gegen den Neoliberalismus« zu veranstalten. Natürlich hatte der Mann schwer einen an der Waffel – aber geht’s noch poetischer …? Zur gleichen Zeit las ich allerdings Ches Bolivianisches Tagebuch, das mit seinem Existenzialismus der verzweifelten Isolation das völlig humorlose Gegenstück zu den drolligen Aktionen der mexikanischen Zapatisten bildete.
Das war wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Je länger ich die Abenteuer des argentinischen Ex-Arztes nachverfolgte, der in völliger Verkennung der Sachlage und blindem Aktionismus versuchte, mit einer Handvoll Desperados, die den bombastischen Namen »Nationale Befreiungsarmee« trug, in Bolivien eine sozialistische Revolution herbeizuführen, desto fremder wurde mir das alles. Die besonderen Umstände, die in Kuba zum Erfolg geführt hatten, waren eben spezifisch kubanisch und hatten nichts mit irgendeiner weltgeschichtlichen Dialektik tun, als deren Erfüllungsgehilfen sich der Comandante und seine Mitstreiter sahen. Der Andenstaat war stattdessen nichts weiter als die Kulisse für einen Film, in dem sie die Hauptrolle spielten. Ich konnte mich immer weniger mit dieser besonders dämlichen Verkörperung von Rousseaus »Volonté generale« identifizieren, einer selbst ernannten Avantgarde also, die meinte, besser als das Volk zu wissen, was das Volk wollte.
Was wiederum Erinnerungen an den Zwiespalt wachrief, in den mich die radikale Linke in gewisser Weise von Anfang an gebracht hatte. Ich bin Arbeitersohn, und die ein paar Jahre älteren Arzt- und Lehrerkinder, die in der Fußgängerzone der erwähnten Kleinstadt die Kommunistische Volkszeitung verteilten und meinen Vater zur Revolution aufstacheln wollten, erfüllten mich schon als Dreizehnjährigen mit einer gehörigen Portion Befremdnis. Arbeiter sind keine Arbeiter, weil sie von bösen Mächten dazu gezwungen wurden, sondern weil das eben der Weg war, der ihnen im Leben offenstand. Und das wissen die meisten von ihnen. Wenn ihnen jemand zu erzählen versucht, die »Arbeiterklasse« sei in Wirklichkeit ein Vehikel, mit dessen Hilfe »die Geschichte« vorhabe, den kommunistischen Himmel auf Erden zu errichten, werden sie schnell misstrauisch und riechen den Braten. Der in der Regel daraus besteht, dass ein paar verkrachte Bohemiens auf ihrem Rücken versuchen, die Macht im Staat an sich zu reißen. So ganz habe ich das – bei allen Sympathien für den Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung – nie vergessen.
Das Schlimme war ja ohnehin, dass dieser Kampf nicht nur in Bolivien in der Regel geradewegs ins Nichts führte. Von den mexikanischen Zapatisten etwa war am Ende nur noch leere Symbolik zu hören. Hier eine Pressekonferenz, dort eine Demo, schließlich eine großartige Erklärung, die eine noch großartigere Konferenz ankündigte, und immer wieder internationale Treffen, zu denen (um ein böses Wort zu zitieren) »trust-fund babies« aus aller Welt anreisten, also Berufssöhne und ‑töchter, die nach San Cristóbal de las Casas pilgerten, um die total authentischen Indigenen kennenzulernen, die sie von der Plage eben jenes Neoliberalismus befreien sollten, dem sie ihren monatlichen Scheck verdankten. Eine Befreiungsarmee, die nichts befreite. Eine Revolution, die nichts revolutionierte. Eine Widerstandsbewegung, die sich darin erschöpfte, die Jungsteinzeit gegen die Moderne zu verteidigen.
Und so endete das T‑Shirt mit el Che vorne drauf dann als Arbeitskleidung auf dem Bau. Eigentlich ein angemessen proletarischer Rahmen, finde ich. Mein Vater – mittlerweile Rentner – verlor kein Wort darüber, während wir Seite an Seite daran arbeiteten, die Latten für die Dämmung an die Dachbalken zu schrauben. Wahrscheinlich wunderte er sich insgeheim ein bisschen, aber letztendlich war das Konterfei des berühmten Revolutionärs für ihn bloß ein flüchtiges Bild, das gelegentlich über seinen Fernsehschirm gehuscht war. Der Glückliche …
Bin ich also heute »rechts«? Also, bitte … In den Schoß der Kirche bin ich nicht zurückgekehrt, und Leute, die ihre Stellung ihrem Nachnamen, ererbten Millionen oder Vitamin B verdanken, kann ich weiterhin nicht ernst nehmen. Aber ich glaube auch, dass der Mensch einen irreduziblen Kern hat, der weder durch Erziehung, noch durch Arbeitslager oder noch so ausgeklügeltes »Nudging« verändert werden kann. Und dass eine funktionierende, national- und sozialstaatlich organisierte liberale Demokratie ohne imperialistische Ambitionen eine ausgesprochen wertvolle historische Errungenschaft ist, die man nicht leichtfertig utopischen Phantastereien opfern darf. Wahrscheinlich bin ich also ein »Alt-1848er«. Nicht zufällig ist die erfolglose Revolution damals immer noch der Teil der deutschen Geschichte, der mir am meisten Gänsehaut verursacht.
Und die edlen Ideale? Sollen meine Kinder groß werden, ohne jemals das süße Gift der brüderlichen Gemeinschaft aller Menschen genossen zu haben …? Nun, die Ablehnung eines Extrems bedeutet ja nicht, dass man den zugrunde liegenden Wert insgesamt ablehnt – der Mensch ist ebenso wenig ganz und gar brüderlich, wie er ausschließlich in Konkurrenz zueinander leben kann. Wo genau der Kompromiss liegt, den man zwischen den beiden Extremen findet, wird immer Gegenstand des politischen Streits bleiben. Und meinen Kindern wünsche ich (insofern ich mich da überhaupt einmische), dass sie im Leben ein paar Umwege weniger gehen müssen als ich …
Fragen, Anregungen, Kommentare? Einfach eine E‑Mail an kommentar@berndohm.de!