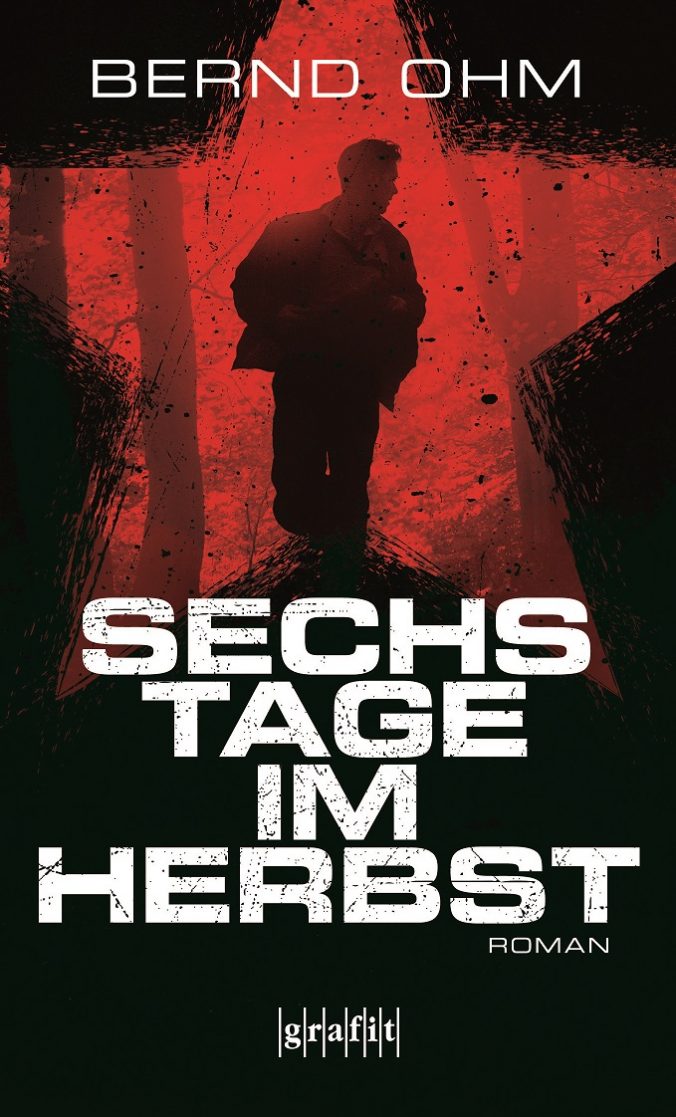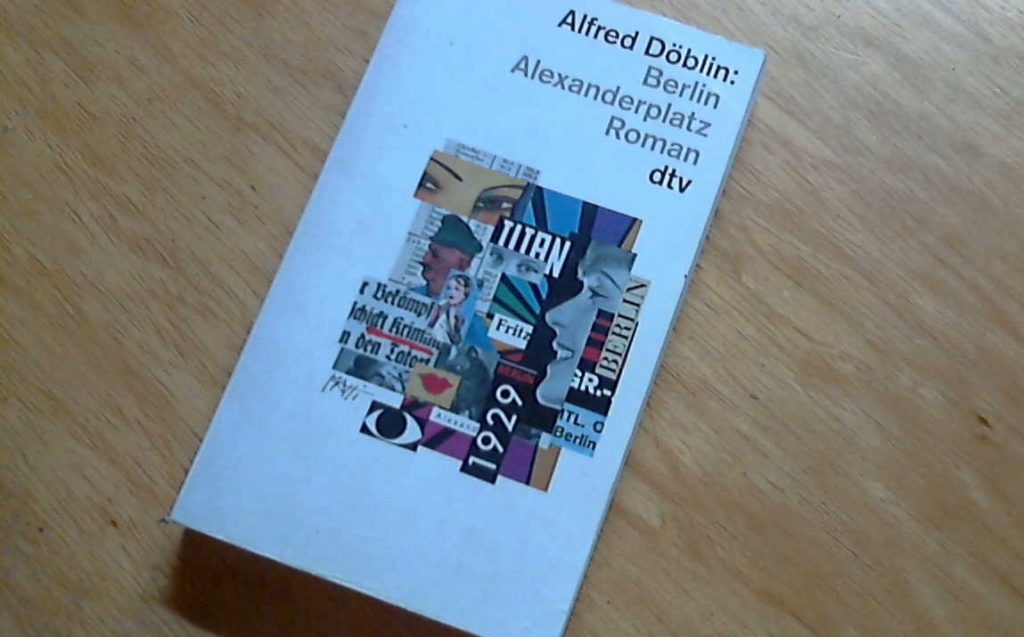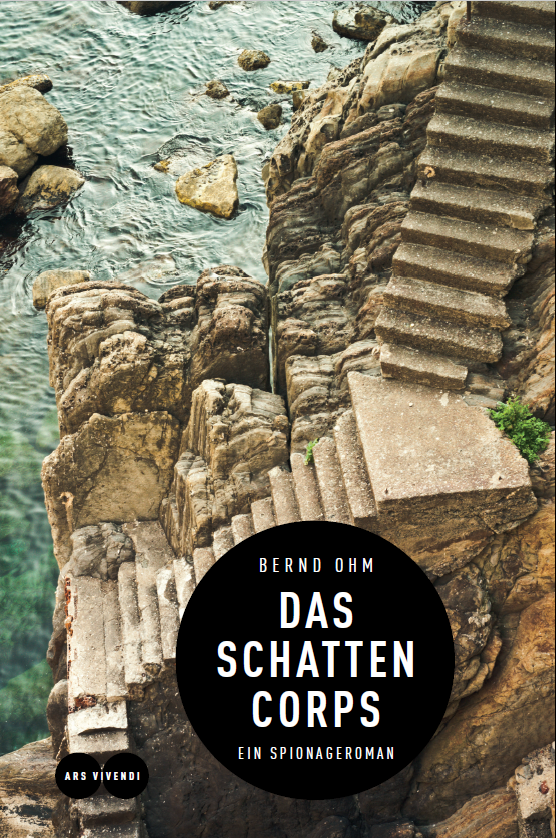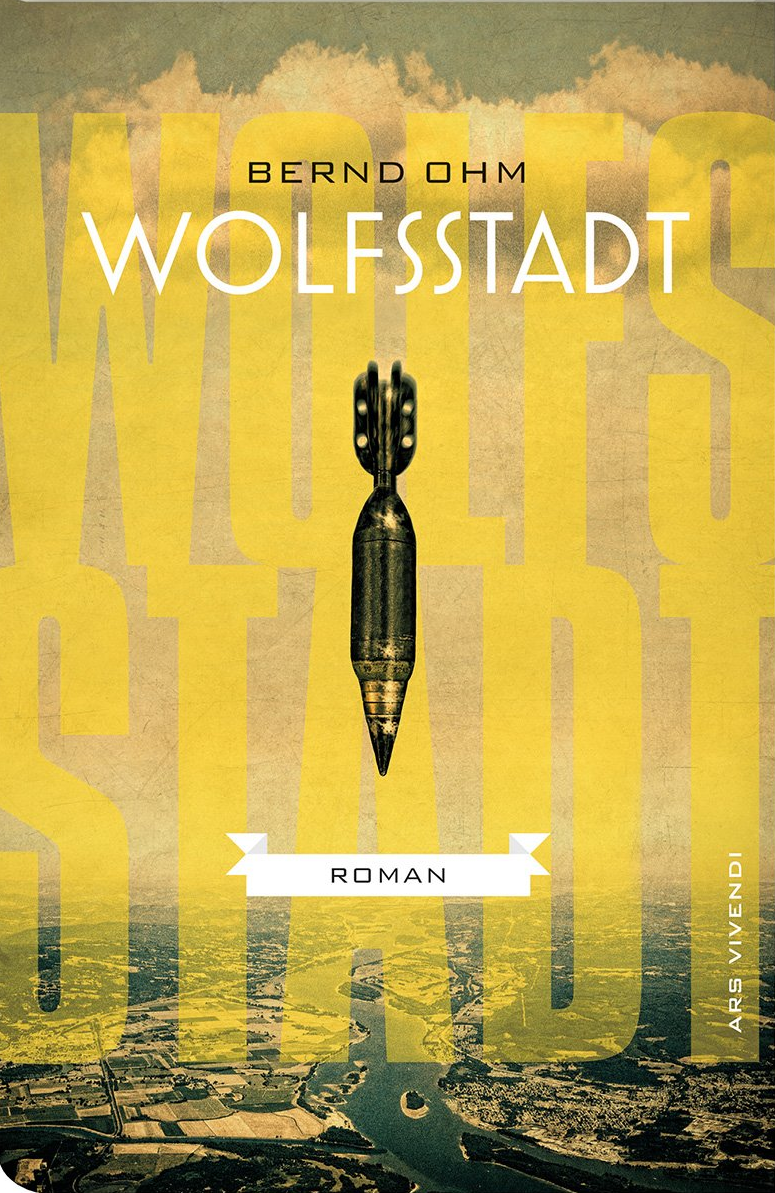Von Syd Field bis Robert McKee versäumt es keiner der bekannten Drehbuch-Gurus, auf die Wichtigkeit des Antagonisten hinzuweisen, wenn es um die dramatische Form einer Geschichte geht. Dieser Gegenspieler der Hauptfigur ist das Haupthindernis auf deren Weg zum dramatischen Ziel, der Katalysator, um neue Erkenntnisse zu erlangen, und die treibende Kraft, von der die entscheidenden Ereignisse des Plots in Gang gesetzt werden. Jedem Harry Potter sein Lord Voldemort, jeder Ripley ihr Alien, jedem J. J. Gittes sein Noah Cross. Ohne Antagonist ist eine Geschichte keine Geschichte, sondern nur eine beliebige Aneinanderreihung von Gegebenheiten und Vorkommnissen. Dabei muss dieses dramatische Grundprinzip nicht unbedingt von einer Person verkörpert werden – es kann auch ein abgespaltener Teil der Persönlichkeit sein wie Tyler Durden in Fight Club, eine totalitäre Ideologie wie in 1984 oder gar ein ganzer Planet wie in Der Marsianer.
Was passieren kann, wenn ein zentraler und überzeugender Antagonist fehlt, lässt sich beispielhaft in der dritten Staffel der Serie Babylon Berlin verfolgen, die gerade in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Ich war ja schon von den ersten beiden Staffeln nur so halb überzeugt, aber im Nachhinein wird mir bewusst, wie sehr der wunderbare Peter Kurth als »Oberkommissar Bruno Wolter« den Laden seinerzeit zusammengehalten hat. Er war der Hauptgegner des stets etwas täppsigen Gereon Rath, er hatte die Fäden in jeder Hinsicht in der Hand, und er konnte so schnell vom Kommandoton in verschlagene Leutseligkeit wechseln, dass es dem Zuschauer kalt den Rücken herunterlief. Ein Prachtexemplar von einem Antagonisten!
Leider starb Bruno Wolter am Ende der 2. Staffel (in einem, mit Verlaub, doch etwas Bruce-Willis-haftigen Finale), und man hat es nicht verstanden, in den neuen Folgen für adäquaten Ersatz zu sorgen. Stattdessen präsentiert man uns den durchgeknallten Leiter des polizeilichen Erkennungsdienstes (der bei seinen früheren Auftritten in der Serie auffällig wenig Durchgeknalltheit erkennen ließ), einen nationalistischen Intriganten, der genauso hölzern agierte wie in den ersten beiden Staffeln, sowie einen farblosen ungarischen Gauner, der noch eine Rechnung mit dem »Armenier« offen hatte. Der Plot fällt dadurch völlig auseinander, und man hat den Eindruck, einer Kollektion zusammenhangloser, aber gewollt hochdramatischer Szenen beizuwohnen, die alle aus ganz unterschiedlichen Filmen stammen: in einem davon wird die Polizei von einem Psychopathen in den eigenen Reihen genarrt, im zweiten kämpft ein integrer Beamter gegen eine perfide politische Verschwörung an, und im dritten wird das ewige Lied vom Bruderzwist im Ganovenmillieu gesungen.
Dies ist natürlich teilweise der »horizontalen« Erzählweise geschuldet, aber in den ersten beiden Staffeln wurden die verschiedenen Handlungsstränge noch wie erwähnt von der »Bruno Wolter«-Figur zusammengehalten; hier gibt es nichts dergleichen. Dadurch treten die vielen kleinen Schwachstellen der Produktion um so deutlicher hervor: die an Selbstparodie grenzenden bedeutungsschwangeren Dialoge, der alberne Versuch, der treudeutschen Welt der Ringvereine ein knallhartes Chicago-Image zu verpassen, die nervigen Ostinati der Filmmusik, die eher an das Postpunk-Kreuzberg der 1980er als an die Goldenen Zwanziger erinnert, die Einfallslosigkeit des Plots (schon wieder eine nationalistische Verschwörung …!), die voyeuristische Lust der Kamera am Ekel. Sogar einen Stephen-King-Moment der »Kriminal-Telepathie« musste man ertragen.
Immerhin ist die deutsche Prestige-Serie nicht die einzige Produktion, die nach dem Ableben des Haupt-Widersachers ihren Schwung verloren hat. Schon The Wire krankt nach dem Sieg über die Barksdale-Bande am Ende der 3. Staffel daran, dass die Erzählung sich zerfasert und immer neue Bösewichte aus dem Hut gezaubert werden, die aber nie wieder das Format von Avon Barksdale und Stringer Bell erreichen. Gleiches gilt für Homeland nach dem Ende Brodys am Baukran in Teheran und Sherlock nach dem Verschwinden Moriartys. Woraus man möglicherweise die Erkenntnis mitnehmen sollte, dass auch ein horizontaler Plot, der sich über mehrere Episoden oder Staffeln einer Serie hinzieht, irgendwann einmal auserzählt ist. Nämlich genau dann, wenn der Antagonist besiegt ist.