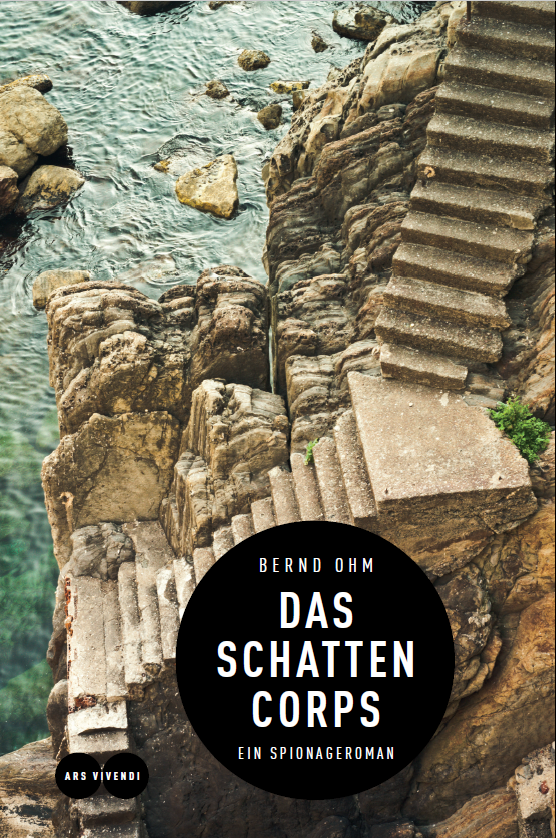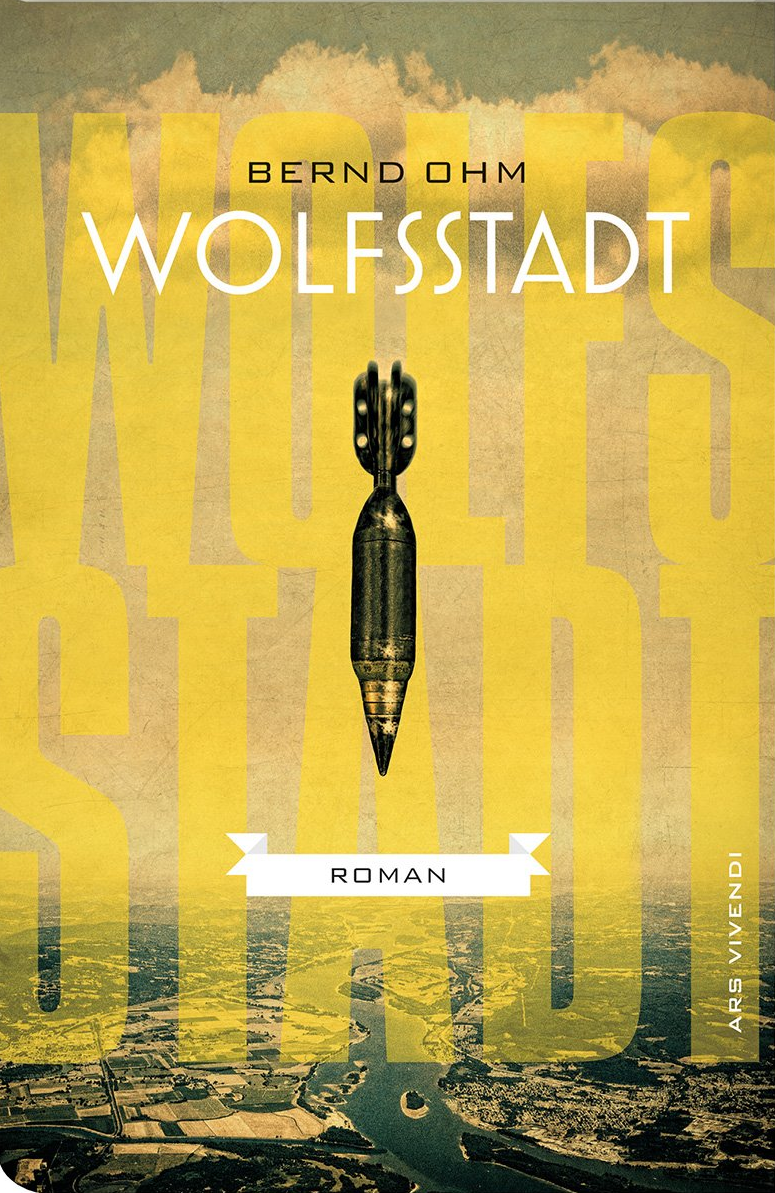Das Schöne an der Zeit vor dem Internet war, dass man noch von Weg abkommen konnte. Nehmen wir beispielsweise Pfingsten 1987 – ich hatte aus irgendeinem Grund, der mir entfallen ist, in München ein Physikstudium aufgenommen, und musste nun eine größere Zahl von Versuchsprotokollen ausarbeiten, um für die zugehörige Lehrveranstaltung einen Schein zu bekommen. Ich glaube, bereits vorhandene Protokolle aus den vorangegangenen Semestern spielten dabei eine nicht unerhebliche Rolle (schummeln konnte man auch ohne Google), aber darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus.
Entscheidend ist, dass ich für ein paar Tage nach Italien heruntertrampte, um die lästige Aufgabe wenigstens in angenehmer Umgebung hinter mich zu bringen. Dabei spielte auch eine gewisse Kathrin eine Rolle – ich glaube, sie studierte Sonderpädagogik –, die mit einer Freundin gerade südlich der Alpen unterwegs war und über die Feiertage eine Jugendherberge südlich von La Spezia ansteuern wollte. Ich rechnete mir einen gewissen Überrumpelungseffekt aus, wenn ich nun unangekündigt in dieser Jugendherberge auftauchen würde, um meine Chancen bei der jungen Dame zu erhöhen, und achtete beim Trampen darauf, dass die Mitfahrgelegenheiten in die richtige Richtung gingen.
Leider hatte ich vergessen, wie der Ort genau hieß, in dem sich das Zielobjekt befand. Heute wäre das natürlich kein Problem – man geht auf die Website des internationalen Jugendherbergsverbands und guckt kurz nach. Oder man steuert La Spezia in der Karten-App an und schaut, ob man südlich davon einen entsprechenden Ort findet. (Es handelte sich übrigens um Marina di Massa.) Aber 1987? Hätte ich vielleicht extra zu Hugendubel fahren sollen, um im Regal mit den Reiseführern die Adresse zu finden? Teures Geld für eine Karte ausgeben? Ach was, einfach mal drauflos, in La Spezia wissen sie schon Bescheid …
Wussten sie leider nicht. Die Dame im dortigen Tourismus-Büro offenbarte beim Thema »ostelli della gioventù« eine bodenlos tiefe Wissenslücke und konnte sich nur düster erinnern, irgendwann mal etwas von einer entsprechenden Einrichtung in Lerici gehört zu haben, einem alten Fischernest am Südende des Golfes von La Spezia, dort sollte ich mich doch am besten selbst umschauen. Immerhin konnte sie mir sagen, welche Buslinie ich dafür nehmen musste, also machte ich mich auf den Weg.
Und dann – na ja, meine ersten Eindrücke habe ich später so beschrieben:
Gott, er liebte das…! Der Bus donnerte im Kamikaze-Tempo die engen Serpentinen zum Meer hinunter, und wenn man dabei die Orientierung behielt, konnte man dieses unglaubliche Blau zwischen den Bäumen hindurchschimmern sehen: Türkis, Himmelsfarben, Aquamarin, tiefes Dunkel wie Samt, vermischt mit dem Umbra der Felsen und dem Ocker der Sandbänke, unterbrochen vom schattigen Grün der Zypressen und Pinien, orangenen, gelben und roten Flecken; Mauerstücke, Ziegel. Ein richtiges Postkartenglück.
Das Städtchen hieß Lerici und lag recht malerisch um eine kleine Bucht am Südende der italienischen Riviera herum verteilt. Einer von diesen beiden englischen Helden der Romantik, war es Byron oder Shelley, sollte hier vor Urzeiten beim Baden im Meer ertrunken sein, also war es nicht besonders überraschend, dass jedes zweite Hotel Shelley, Palma di Byron oder Byron di Shelley hieß, ganz abgesehen von den Massen ältlicher Engländerinnen, die anscheinend einen guten Teil ihrer Bildungsreise durch das Land, wo die Zitronen blühten, damit verbrachten, hier die Uferpromenade auf- und abzulaufen. Wahrscheinlich hofften sie darauf, auf mystische Weise einen Hauch der Seele des verstorbenen Dichters aufzuschnappen; diese aber schwebte gelangweilt über den Wassern und ignorierte sie.
Die Szenerie war so, wie man sich’s wünschte. An den beiden Ecken der Bucht standen ein paar burgartige Überreste von alten, genuesischen Festungsanlagen, im Hafen schaukelten friedlich diverse Yachten und Segelboote vor sich hin, die Häuser hatten alle so einen leicht angegilbten, südlichen Charme, gleich dahinter stiegen die dichtbewachsenen Felsen auf – und überhaupt, wenn er je im Leben von Italien geträumt hatte, musste das genauso ausgesehen haben wie Lerici.
Mit anderen Worten: Es war Liebe auf den ersten Blick. Wie ich später herausfand, hatte die Jugendherberge in der alten Burg bereits Ende der 1960er zugemacht, jetzt befand sich ein Museum für Paläontologie in dem Gemäuer. Aber das war mir egal. Ich suchte mir ein Hotelzimmer, das ich mir gerade noch so leisten konnte, und schwebte durch die Gassen wie von Elfen verzaubert. Diese Farben! Dieser Duft! Diese Menschen! Sogar Kathrin vergaß ich umgehend und lernte dafür Gianna kennen, mit der ich ein paarmal die Mole auf- und ablief, immer zwischen dem Blick auf das weite Meer und dem in ihre rehbraunen Augen hin und herpendelnd. Leider beherrschte ich die Landessprache nicht und sie nur diese, sodass wir nur nonverbal kommunizieren konnten. Aber wird Sprache nicht ohnehin überbewertet …?
Wie man sich denken kann, war ich später noch öfter in dem kleinen Städtchen, das außer bei englischen Shelley-Fans nie den Status des Geheimtipps verloren hat. Die typischen deutschen Touristen wandern lieber auf der anderen Seite des »Golfo dei Poeiti« in den Cinque Terre, weil man sich da so hübsch an der urigen Armut der Olivenbauern weiden kann, und wer ligurische Fischerdorfromantik pur will, fährt eben nach Portofino.
Ich nicht. Im Laufe der Jahre erfuhr ich, dass die bewusste Jugendherberge eigentlich ein Künstlertreff gewesen war, in dem sich in den 1950ern Hemingway und andere Größen die Klinke in die Hand gegeben hatten. Die Kastellanin und Herbergsmutter Maddalena Di Carlo, eine etwas exzentrische alte Dame, war bekannt dafür, nachts die Katzen von Lerici mit den Spagettiresten des Abendessens zu füttern, ihr Zimmer war ein Sammelsurium von Kunstwerken und Kitschobjekten, die ihr Gäste aus aller Welt geschickt hatten, sie stieg sogar gelegentlich auf den Bergfried und betete zu den Windgöttern. Alle Welt nannte sie »Regina dei vagaboni«, die Königin der Vagabunden. Vielleicht kannte sie Rudolf Jacobs, einen aus Bremen stammenden Architekten, der im 2. Weltkrieg als Offizier für die Festungsbauten im Golf von La Spezia zuständig war und in Lerici wohnte. Als er die Gräueltaten von SS und Mussolinis Schwarzhemden nicht mehr ertrug, lief er zu den italienischen Partisanen über und kam bei einer Aktion im nahen Sarzana ums Leben. Noch heute verehren ihn die Italiener als Helden.
Ansonsten gibt es gar nicht so viel berichten aus dieser Ecke der Welt. Der Hafen war vor langer Zeit im Mittelalter von einer gewissen Bedeutung, weil sich hier die Genuesen mit den Pisanern stritten und die hinter den Bergen liegende Lunigiana einen Zugang zum Meer brauchte. Dante hat die Burg mal irgendwo erwähnt, Arnold Böcklin lebte für kurze Zeit in der Gegend, genauso D.H. Lawrence und Emma Orczy. In der Literatur spielt der Ort keine große Rolle.
Ich fand, es war mal Zeit, das zu ändern …