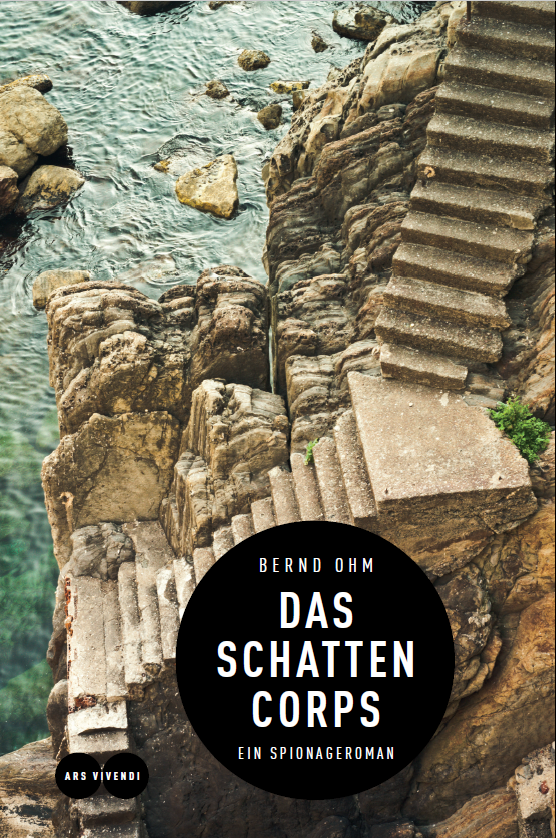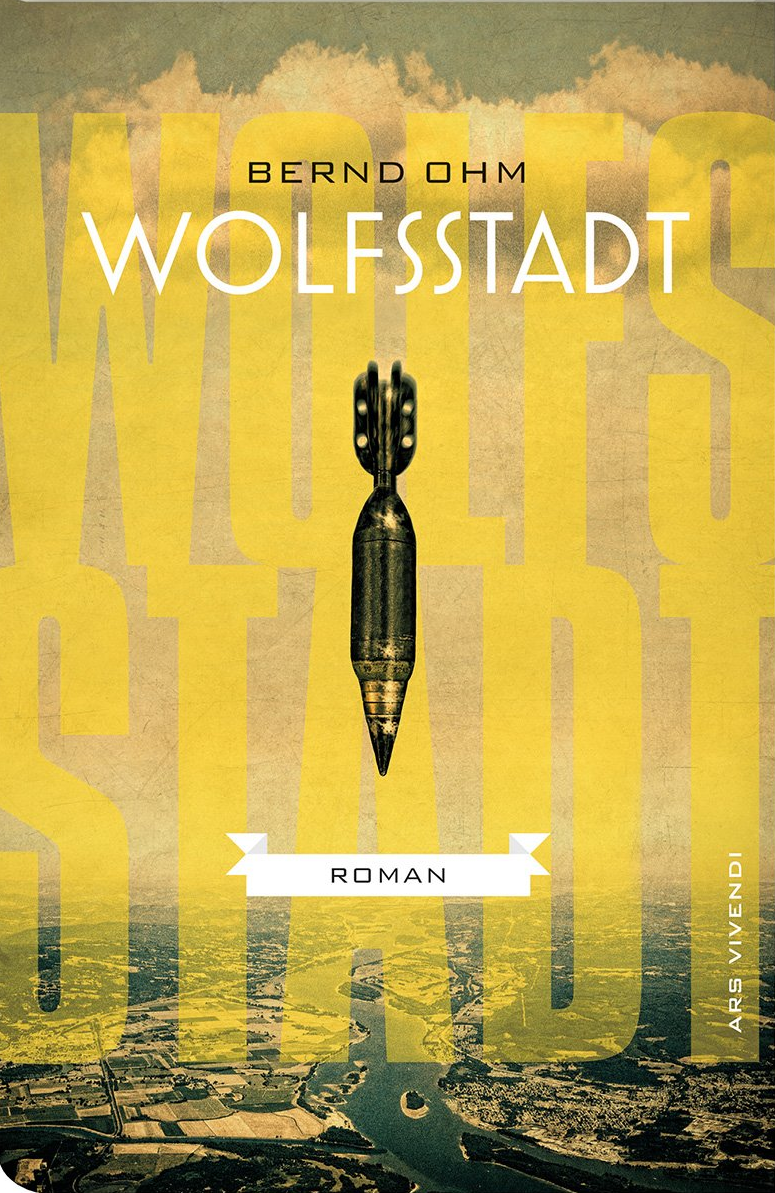Die junge Schwedin hat etwas bewirkt, das muss man ihr lassen. Man weiß nie so recht, ob sie sich das alles selbst ausgedacht hat oder nur ein cleveres PR-Produkt ist, aber immerhin reden wir dank ihrer Aktionen wieder über Dinge, die wichtig sind, anstatt über Trumps Haartolle. Was mich etwas irritiert, ist diese ebenso panische wie folgenlose Hysterie, die um sich greift – plötzlich reden alle aufgeregt vom »Klimanotstand« und trompeten halluzinierende Forderungen wie »Kohleausstieg jetzt!« in die Welt, ohne dass man den Eindruck hat, dass sie sich mit den tieferen Dimensionen des Problems wirklich beschäftigt haben. Und offenbar ohne dass sie für sich selbst Konsequenzen daraus ziehen – freitags für die Future, mittwochs zu Ferienbeginn in den Flieger.
Welche Dimensionen das wären? Man kann sich der Angelegenheit von mehreren Seiten nähern. Eine davon ist das simple Eingeständnis, dass die Erzeugung von Kohlendioxid durch Verheizen fossiler Brennstoffe einen Riesenspaß macht, den Horizont erweitert und zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Bei einen Flug Frankfurt-Rio hin und zurück beispielsweise werden über sechs Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen (wer’s nachrechnen will: www.klimanko.de), aber die Reise, die ich vor vielen Jahren auf diese Weise gemacht habe, war eine der prägenden Erfahrungen meines Lebens. Ich habe große Teile Brasiliens und auch ein bisschen von Argentinien und Paraguay gesehen, die Wasserfälle von Iguaçu, die Ruinen der Jesuiten-Missionen am Paraná, den Pelourinho von Salvador, den Monster-Verkehrsstau von São Paulo und und und. Ich habe an einem Candomblé-Ritual teilgenommen und in einer República gewohnt. Ich habe jede Menge Brasilianer kennengelernt und – wie schon Jahre zuvor in den Vereinigten Staaten – relativ ernüchtert feststellen müssen, dass man ein Land nicht versteht, bloß weil man seine Populärmusik hört und ein paar seiner Autoren gelesen hat. Und gelernt, dass man in Rio nachts nicht an roten Ampeln hält, weil sonst ein paar üble Burschen mit Maschinenpistolen kommen und einem an Geldbeutel und Leben wollen … Ich wäre nicht derselbe Mensch, wenn ich diese Reise damals nicht gemacht hätte. Aber es bleiben die sechs Tonnen CO2 (die dazugehörigen brasilianischen Inlandsflüge habe ich jetzt geschickt unterschlagen), und es war weiß Gott nicht der einzige Langstreckenflug meines Lebens.
Das gleiche gilt natürlich auch für einfachere Vergnügungen wie den spontanen Auto-Ausflug an den Chiemsee, die Fahrt über kurvige Küstenstraßen in Kampanien und den All-American Roadtrip von New York nach Kalifornien. Wie wäre wohl eine Welt, in der solche Freuden verboten oder so teuer wären, dass nur ein paar Reiche das nötige Kleingeld dafür aufbringen könnten? Ein eher trister Ort, nehme ich an, da kann man mir die Vorteile von »Localism« und »Slow-Bewegung« in noch so glühenden Farben ausmalen. Es ist ja kein Wunder, dass die Vorsitzende der bayerischen Grünen gerne über den Jahreswechsel nach San Diego jettet, um dort ein Eis zu löffeln … Diese Scheinheiligkeit kennt man aus zwei Jahrtausenden Christentum zur Genüge, und man darf annehmen, dass die »Klimabewegung« bei ihrem Vorhaben, den Durchschnittsmenschen auf den rechten Pfad der Dekarbonisierung zu bringen, genauso erfolglos sein wird wie dieses, wenn die Sünde doch so schön ist.
*
Ein anderer Aspekt des Dilemmas besteht darin, dass fossile Brennstoffe nicht nur Spaß machen, sondern auch Kräfte verleihen, die unsere Vorfahren nur aus Märchen und phantastischen Erzählungen kannten. Siebenmeilenstiefel? EasyJet würde mich nächsten Monat für schlappe 30 Euro in zwei Stunden von Hamburg nach Nizza bringen. Riesen, die Zyklopenmauern auftürmen? Macht heute der Raupenkran LR 13000 mit 3000 Tonnen Tragkraft und 1000 Kilowatt Motorleistung. Feuerspeiende Drachen? Die F‑22 Raptor verbreitet ihre tödliche Fracht viel schneller und effizienter.
Das hat einen einfachen Grund: Ein körperlich arbeitender Mensch bringt langfristig eine durchschnittliche physikalische Leistung von allerhöchstens 100 Watt aufs Tapet (Leistungssportler kurzfristig viel mehr, siehe unten das Video). Um täglich eine einzige, müde Kilowattstunde zusammenzubekommen, muss er also schon zwei Überstunden machen. Und die ungefähr drei Kilowattstunden, die an nutzbarer Energie in einem bescheidenen Liter Diesel stecken (bei 30 % Wirkungsgrad des Motors), halten ihn drei bis vier Tage auf Trab. Im Gegensatz dazu setzen wir Geistesarbeiter ein Vielfaches dieser Leistung auf Knopfdruck frei, ohne auch nur darüber nachzudenken. Eben mal kurz den Staubsauger anwerfen? Sechs oder sieben unsichtbare Helfer à 100 Watt saugen mit. Das Gaspedal durchdrücken, um den SUV auf die Überholspur zu bringen? Bei 100 Kilowatt Motorleistung sind es mindestens tausend Mann, die hinten schieben. Und der oben erwähnte LR 13000 setzt eine ganze Kleinstadt an virtuellen Helfern ein, um seine Tonnenlasten zu stemmen.
Diese Überlegungen wurden schon vor Jahrzehnten von dem US-Autor Richard Buckminster Fuller in dem Begriff der »Energiesklaven« zusammengefasst, die jedem für uns ständig zu Diensten sind, um die Vielzahl von Maschinen zu bewegen, deren Arbeit wir unser Märchendasein verdanken. Nach Berechnungen des deutschen Physikers Hans-Peter Dürr arbeiten demnach für jeden Amerikaner 110 solcher unsichtbaren Sklaven, für jeden Europäer immer noch 60. Eine jüngere, etwas detailliertere Rechnung kommt sogar auf eine Truppe von 400 Mann für den durchschnittlichen Franzosen.
Und diese freundlichen, allzeit bereiten Helfer sind spottbillig! Im Gegensatz zu tatsächlichen Sklaven, die viel mehr Energie in Form von Nahrung verbrauchen würden, als sie Arbeit leisten könnten, enthalten fossile Brennstoffe ein Mehrfaches der Energie, die in ihre Gewinnung investiert werden muss. Bei in den USA gefördertem Erdöl liegt dieses auch als »Erntefaktor« oder »EROEI« (Energy Returned on Energy Invested) bezeichnete Verhältnis zwischen 10:1 und 20:1, während deutsche Kohle- oder Gaskraftwerke sogar um die 30:1 bieten. Auch hierfür ist der Grund ganz einfach: Fossile Brennstoffe sind im Grunde nichts weiter als gespeichertes Sonnenlicht, das in Form von toten Tieren und Pflanzen über geologische Zeiträume hinweg im Erdinnern konzentriert wurde, ohne dass irgendjemand etwas dafür tun musste. Es ist, als hätte der Planet für uns mehrere Millionen Jahre lang jedes Jahr die Summe angespart, die man durch ehrliche Arbeit erwirtschaften kann, und dann waren einfach irgendwann mehrere Fantastilliarden auf dem Konto, für deren Gewinnung man nur noch ein paar Löcher in den Boden graben musste. Wir konnten der Versuchung nicht widerstehen und haben konsequenterweise in den letzten Jahrzehnten einen großen Teil dieses unverhofft geerbten Vermögens hemmungslos durchgebracht.
Könnten wir darauf verzichten? Wie denn wohl … Wir alle leben in Umständen, die ohne die jederzeitige Verfügbarkeit von Unmengen billiger Energie nicht denkbar wären. 50 oder 70 Kilometer Arbeitsweg? Kein Problem. Eine Riesen-Gefriertruhe, um nicht so oft einkaufen zu müssen? Kein Problem. Trotzdem ein großes Auto, weil man ja auch mal mit den Kindern und ihren Freunden in den Freizeitpark fahren will? Kein Problem. Der neueste Riesenfernseher aus Korea? Kein Problem. Weintrauben aus Chile? Kein Problem. Die schönen Bodenfliesen aus Italien? Kein Problem. Ein Shopping-Wochenende im Big Apple? Kein Problem. Wir können uns das alles leisten, weil wir selbst Maschinen für uns arbeiten lassen und die Produkte unserer Fabriken in die ganze Welt verkaufen. Alles, was irgendjemand irgendwo mit Hilfe von Maschinen und fossiler Energie herstellt, anbaut oder transportiert, ist so billig, dass kein Erzeugnis von unmittelbarer Menschenhand damit konkurrieren kann. Das klimaneutrale Gemüse, das wir im eigenen Garten ziehen, oder der Pulli aus Wolle von eigenen Schafen sind vielmehr Knochenjobs mit höchstens 100 Watt.
*
Nach einem Wort des US-Soziologen William Catton macht uns diese Maschinenwelt mit der hundertfachen Verstärkung unserer Körperkräfte zu Homo colossus, und selbst wenn wir ökologisch korrekt einkaufen, nur noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen und das Wohnzimmer mit einheimischem Buchenholz heizen, schaffen wir es damit gerade mal, zu Homo colossus inferior zu schrumpfen. Von echter »Nachhaltigkeit« bleiben wir weit entfernt.
Bleibt also, und das ist die dritte Sichtweise auf das Problem, die Hoffnung, unsere Energiesklaven irgendwie anders als mit fossilen Brennstoffen zu füttern. Um die damit verbundene Herausforderung zu verstehen, ist es nützlich, kurz auf den Kirchturm unseres kleinen, beschaulichen Dorfes zu steigen, der einen guten Blick auf die Umgebung bietet. Wir befinden uns hier in einer weiten, von Schmelzwassern der vorletzten Eiszeit geschaffenen Ebene (für Kenner: ein Teil des Breslau-Magdeburg-Bremer Urstromtals), über der öfter mal ein ganz hübsch steifer Westwind weht. Wie man sich denken kann, hat dieser Umstand die Gegend in den vergangenen zwanzig Jahren für eine bestimmte Art von Bauprojekt interessant gemacht.
Das erste davon sehen wir knapp zwei Kilometer südlich des Dorfes: 12 Windräder eines kleinen Windparks, von denen die jüngsten beiden vom neuesten Typ und so hoch sind, dass sie seit ihrer Errichtung das Dorf optisch erschlagen. In sieben Kilometer Entfernung in Richtung West-Nordwest folgen 22 Windräder des nächsten Windparks, direkt im Westen stehen in zwölf Kilometer Entfernung weitere 8 Anlagen, und mit vier Kilometern wieder näher dran befinden sich ebenfalls 22 Windräder im Nordwesten des Dorfes. Im Norden und Osten existiert aufgrund des Weserlaufs eine gewisse Windradlücke, aber mit 2 Anlagen in Richtung Nordost (2,5 km Entfernung) und 15 Windrädern im Südosten (8–10 km Entfernung) arbeitet man daran, auch diesen Bereich mit einzubeziehen. Bei klarer Sicht kann man sogar noch weiter entfernte größere Windparks ausmachen, aber die kleine Auswahl sollte wohl für einen ersten Eindruck genügen. Demnächst kommen noch eine neue Hochspannungsleitung und ein großes Umspannwerk hinzu, weil der Strom natürlich auch irgendwie dorthin muss, wo er gebraucht wird.
Wie effektiv ist das alles? 2018 kamen den Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen zufolge 35 Prozent des gesamten in Deutschland erzeugten Brutto-Stroms aus erneuerbaren Quellen, davon gut 17 Prozent von Windkraftanlagen und 7 Prozent aus Fotovoltaik. Das klingt zunächst mal ganz gut – allerdings nur, bis einem einfällt, dass Strom nur eine von vielen Energieformen ist. Häuser werden zumeist mit Erdgas oder Heizöl geheizt, Autos fahren mit Benzin oder Diesel, und in der Industrie braucht man neben Strom auch Erdgas und weitere Brennstoffe, um Prozesswärme zu erzeugen und andere Aufgaben zu erledigen. Wenn man alles zusammenzählt, kommt man zu dem deprimierenden Ergebnis, dass laut Bundesministerium für Wirtschaft 2017 (die genauen Daten für 2018 fehlen noch) der Anteil von Wind- und Solarstrom zusammengerechnet beschämend geringe 4 Prozent des Gesamt-Primärenergieverbrauchs betrug, während 80 Prozent weiterhin durch fossile Brennstoffe erzeugt wurden.
Als ich das gelesen habe, musste ich mich erst mal setzen. Der ganze WKA-Wald, der hier um das Dorf herum entstanden ist, die ganzen Solarparks, mit denen man in Süddeutschland noch die letzte Schafweide bebaut hat, und dann ein derart blamables Ergebnis …?!? Und es kommt noch schlimmer: Wenn man, was ja der neueste Plan der Regierung zu sein scheint, das gesamte Land bis 2050 »klimaneutral« machen möchte, müssen die klimawirksamen 80 Prozent entweder abgeschafft oder durch irgendetwas anderes ersetzt werden. Was könnte das sein? Sieben Prozent des Bruttostroms werden mit Hilfe von Biogas erzeugt, ein knappes Prozent der Primärenergie stammt aus Biosprit. Für beide Energieformen zusammen werden allerdings bereits 20 Prozent des deutschen Ackerlands verwendet, sodass nach oben wohl nicht mehr allzu viel Luft ist. Irgendetwas wollen wir ja auch noch essen, und noch mehr Import von Biosprit aus Palmöl könnte das endgültige Ende des tropischen Regenwalds bedeuten … Als nächstes würde einem dementsprechend der einheimische Wald einfallen. Aber hier werden bereits 87 % des jährlich nachwachsenden Rohholzes für andere Zwecke genutzt (Bauholz, Möbel, Brennholz für den Wohnzimmerkamin usw.), es ist also so gut wie überhaupt kein Ausbaupotenzial mehr vorhanden. Zudem ist ein Transport von Holz von vielen verschiedenen Standorten zu einem zentralen Kraftwerk ökonomisch nicht besonders sinnvoll; bereits bei Braunkohle, die einen etwas höheren Heizwert aufweist, werden ja die Kraftwerke möglichst direkt neben den Gruben gebaut, um die Transportkosten zu minimieren. Ebenso wenig darf man auf einen Ausbau der Wasserkraft hoffen: Laut Umwelt-Bundesamt hat auch diese Art der Energieerzeugung ihr Potenzial weitestgehend ausgeschöpft. Und ernsthaft – wollten wir wirklich Rhein, Donau und Elbe durch Staustufen mit Laufwasserkraftwerken so kanalisieren, wie es im 20. Jahrhundert mit der Weser geschehen ist, um den Preis, hinterher ökologisch tote Flüsse zu haben …?
Bleiben Wind und Sonne. Und eine einfache Kopfrechenaufgabe: Wenn momentan 4 Prozent der Primärenergie aus diesen beiden Quellen stammen und weitere 86 Prozent dadurch ersetzt werden sollen (die zusätzlich nötigen 6 Prozent stammen von den stillzulegenden Kernkraftwerken), um welchen Faktor müsste die Zahl der Windräder und Solaranlagen dann steigen …? Wie viele Groß-Stromspeicher und Wasserstoffanlagen bräuchte man, um die Schwankungen von Wind und Sonne auszugleichen? Und wie sähe nachher die Umgebung unseres kleinen, beschaulichen Dorfes aus? Oder besser gesagt, wie sähe dann das ganze Land aus? Man hätte es zerstört, um es zu retten.
*
Für einen vierten – und letzten – Aspekt muss ich nochmal auf meine eingangs erwähnten Fernreisen zurückkommen. Einige davon führten mich im Abstand von jeweils mehreren Jahren nach Südostasien, und ich hatte Gelegenheit, vor Ort ein anschauliches Bild davon zu gewinnen, was »wirtschaftliche Entwicklung« bedeuten kann. Ich denke da insbesondere an eine Insel im südchinesischen Meer, die bei Backpackern damals recht beliebt war, weil sie dank des günstigen Wechselkurses auch für kleines Geld ein paradiesisch-tropisches Ferienerlebnis ermöglichte. Bei meinem ersten ersten Besuch, das muss 1993 gewesen sein, kamen wir in einer Stelzenhütte mit Palmblattdach unter, die meiner Erinnerung nach den Gegenwert von ungefähr 5 US-Dollar die Nacht kostete. Auch der Besitzer der Hüttenanlage, ein Thai mit chinesischen Wurzeln, wohnte mit seiner Familie unter ähnlichen Umständen. Eigentlich handelte es sich um einen alten Kokospalmenhain, und er hatte sich nicht die Mühe gemacht, die Bäume zu fällen, sodass es den ganzen Tag über schön schattig war. Die Rezeption bestand aus einem Fenster mit Klappladen, an dem man auch Bestellungen für das zugehörige Restaurant aufgeben sowie Getränke und Snacks kaufen konnte. Man hatte nicht das Gefühl, dass die Besitzerfamilie sich totarbeitete, und wir Touristen übten uns in Entschleunigung und tropischer Losgelöstheit vom Rummel zu Hause in Europa oder Nordamerika. Was sollte sich an diesem zeitlosen Ort jemals ändern …?
Wie man sich täuschen kann. Zwei Jahre später waren die Palmen im östlichen Teil des Geländes verschwunden und eine Reihe von weiß verputzten Bungalows an ihre Stelle getreten. Nochmal fünf Jahre später habe ich dort die erste Fassung von Wolfsstadt geschrieben, und jetzt gab es nur noch Bungalows und ein aus Beton errichtetes neues Restaurant direkt am Meer. Der Sohn des Besitzers war erwachsen geworden und hatte eine hübsche Papaya-Verkäuferin geheiratet, die aus dem Norden auf die Insel gekommen war. Er fuhr einen nigelnagelneuen BMW und hatte ziemliches Übergewicht; die Zahl der Palmen war hingegen deutlich zurückgegangen. Ein Jahr später war das Restaurant einer Sturmflut zum Opfer gefallen, wurde aber gerade viel größer und schöner neu errichtet. Und als ich vor kurzem im Internet nachgeschaut habe, was aus der Ecke so geworden ist, musste ich einigermaßen schlucken: Am Ort des gemütlichen Kokospalmenhains mit Stelzenhütten macht sich jetzt ein 5‑Sterne-Beach-Resort mit Innenarchitektur und Privatpool-Bungalows breit, in denen eine Übernachtung mehr als hundertmal so viel kostet wie damals.
Die Anlage wird mittlerweile von einem internationalen Hotelkonzern betrieben, aber man macht es sich allzu leicht, wenn man das Geschehen einfach dem bösen westlichen Kapitalismus anlastet: Der jetzige Zustand ist ja nur der logische Endpunkt einer Entwicklung, die bereits unter den einheimischen Besitzern begonnen hat. Die Wahrheit dürfte vielmehr darin bestehen, dass diese Menschen der Versuchung, zu Homo colossus zu werden, ebenso wenig widerstehen können wie wir. Anders ist wohl nicht zu erklären, warum etwa die Regierung von Bangladesch gerade dabei ist, in genau jenem Ganges-Delta, das bei einem Anstieg des Meeresspiegels als erstes überflutet würde, ein riesiges Kohlekraftwerk zu bauen. Oder warum in Indien für die nächsten 15 Jahre der Bau von 100 neuen Flughäfen geplant ist. Oder warum chinesische Touristen mittlerweile ein Fünftel der weltweiten Tourismusausgaben tätigen. Während wir hierzulande über das Abschalten von 45 Gigawatt Kohlestrom streiten, werden weltweit 399 Gigawatt an neuen Kohlekraftwerken gebaut. Wollen wir es den betreffenden Ländern verbieten, weil wir selbst schon so viel CO2 produziert haben …?
*
Um es nochmal zusammenzufassen: Homo colossus müsste, um den von ihm verursachten Klimawandel zu stoppen, entweder aufgeben und in die 100-Watt-Welt seiner Vorfahren zurückkehren oder einen neuen Weg finden, seine Maschinen anzutreiben. Momentan sind all unsere Anstrengungen auf das zweite Ziel gerichtet, aber es zeichnet sich schon ab, dass der dabei verfolgte Weg hoffnungslos inadäquat ist. Zudem wird jeder Fortschritt an Dekarbonisierung, der durch den Einsatz regenerativer Energien oder persönlichen Verzicht entsteht, durch den Wunsch der restlichen Welt, möglichst rasch unserem Vorbild zu folgen, wieder zunichte gemacht.
Was also tun? Zunächst mal: Ruhe bewahren. Der Weltuntergang wurde in den letzten Jahrzehnten schon ziemlich oft angekündigt, um dann doch nicht einzutreten. Insbesondere Internetmeldungen des Kalibers »Wenn wir nicht innerhalb von10 Jahren kein CO2 mehr ausstoßen, läuft die globale Erwärmung völlig aus dem Ruder und die Erde ist 2050 unbewohnbar« sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ob die für die jeweilige Prognose verwendete Modellrechnung wirklich stimmt, werden wir erst in ein paar Jahrzehnten sicher wissen. Trotzdem sollte man natürlich nicht die Hände in den Schoß legen – dass die Prognosen komplett danebenliegen, kann man ebenso wenig beweisen wie ihre hundertprozentige Richtigkeit. Zudem ist es mittel- bis langfristig sinnvoll, sich von den fossilen Brennstoffen zu verabschieden, schließlich werden sie nicht ewig reichen. Dafür hätte ich einen Vorschlag: Wir geben uns alle mal einen Ruck und akzeptieren, dass Flugreisen, große Autos, Kreuzfahrten, Fleischkonsum und überhaupt alle Nicht-Lebensnotwendigkeiten besteuert werden, dass es quietscht (womit ich meine: viel stärker, als es momentan Robert Habeck vorschwebt). Das hat nichts mit Askese zu tun, denn das dadurch eingenommene Geld muss in die Grundlagenforschung gesteckt werden, um neue Quellen billiger, hochkonzentrierter Energie zu erschließen: Kernfusion, hocheffiziente Wasserstoff-Elektrolyseure, was auch immer. Man müsste zwar den Gürtel enger schnallen, hätte aber die Aussicht, dass sich als Belohnung ein neuer Weg auftut, unsere Hightech-Welt anzutreiben. Einer, dem der Rest der Welt dann auch wieder bereitwilliger folgt als unserer chaotischen Wind- und Solarpark-Bauwut. Das wäre es doch wert, oder?
In diesem Zusammenhang ließe sich übrigens erwähnen, dass Kernkraftwerke laut der oben verlinkten Studie einen Erntefaktor von nicht weniger als 75:1 aufweisen, von daher wären die 520 Milliarden Euro, die die Energiewende bis 2025 kosten soll, vielleicht besser dafür ausgegeben worden, diese Technik so weiterzuentwickeln, dass die Anlagen nicht mehr durchgehen können, kein Waffenmaterial produzieren und den bereits angefallenen Atommüll als Brennstoff nutzen können. Nur so meine bescheidene Meinung, aber zumindest kurzzeitig scheint das ja auch Greta aufgefallen zu sein …