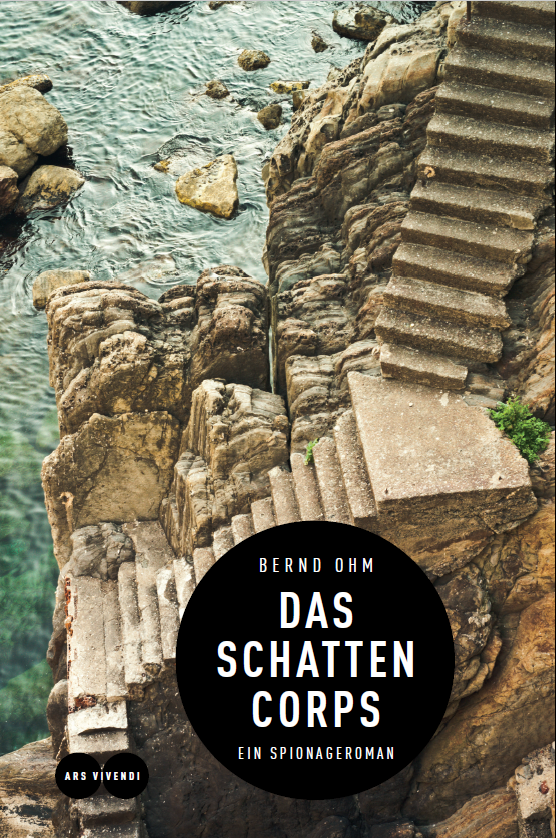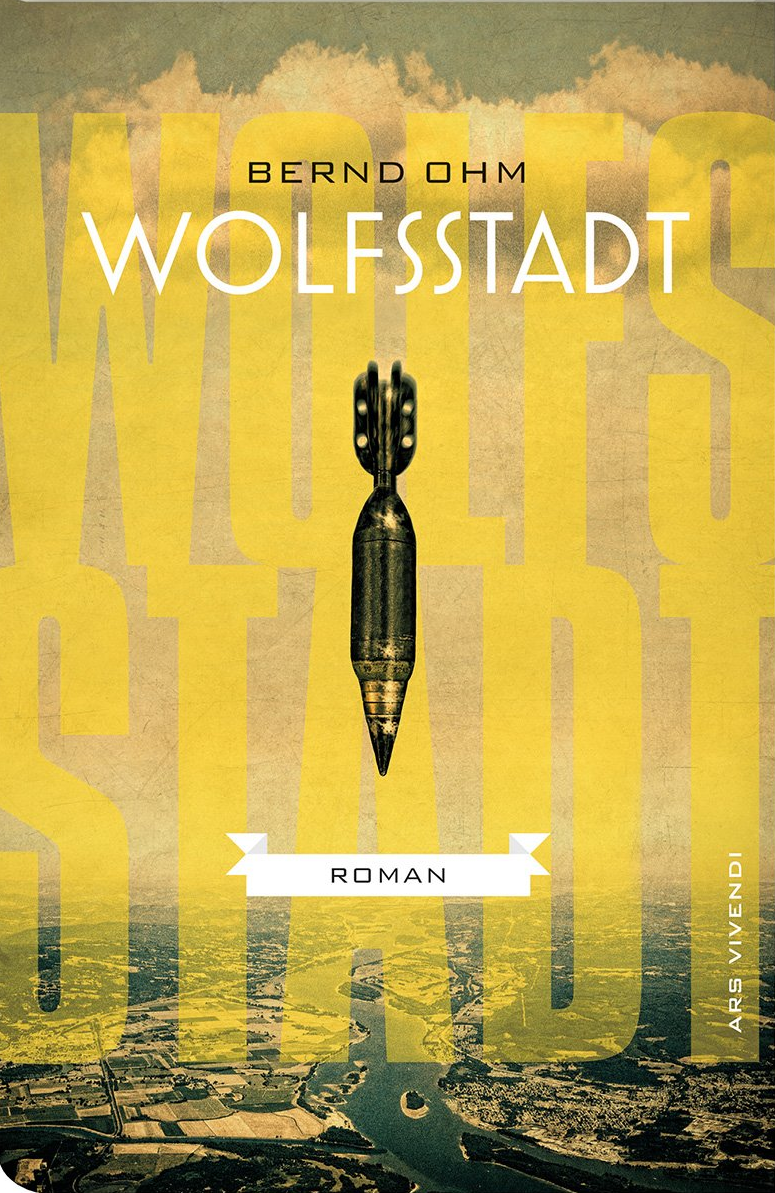Ich weiß gar nicht so genau, woran es liegt. Vielleicht an dem Schwall aus Urin und Erbrochenem, der einem aus dem U‑Bahn-Aufgang an der Möckernbrücke entgegengeweht kommt. Oder an den Halbstarken, die lautstark und aggressiv auf Arabisch durch den Waggon pöbeln und sich dabei keinen Deut um die anderen Fahrgäste scheren. An den jungen Türkinnen auf dem Kottbusser Damm, die Kopftücher und knöchellange Mäntel tragen und mit ihren Kindern wie gewohnt in der Muttersprache Präsident Erdoğans reden. An den Proleten in Jogginganzügen, die am hellichten Tag ihre Bierflaschen aufmachen und einen aus wässrig-grauen Augen lauernd anstarren, jederzeit bereit zur Explosion. An die obligatorischen Matratzen, die selbst über die Osterfeiertage die Bürgersteige vollmüllen. An der unbezähmbaren Lust der Bewohner dieser Stadt, auch die schönste Eingangstür und den glänzendsten neuen Hausanstrich ohne Umschweife mit hässlichem Geschreibsel zu überziehen. An dem bleiernen Himmel, der einen selbst bei frühlingshafter Wärme in die Depression treibt.
In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich enttäuschte Liebe. Als ich vor Jahr und Tag das schrecklich reiche und aufgeräumte München verließ, um meine Zelte an der Spree aufzuschlagen, gab es das alles auch schon, aber es hat mich eigentlich nicht weiter gestört. Im Gegenteil, schien es sich doch um typische Charaktereigenschaften einer echten Metropole zu handeln, allenfalls um Geburtswehen einer großartigen, neuen Zeit, die hier heraufdämmerte und mir einen Logenplatz im großen Theater der Weltgeschichte bieten würde. All die jungen Leute aus aller Herren Länder, all der frische Wind nach vier Jahrzehnten sozialistischem Mief! Die ganze Stadt war irgendwie auf Anfang, und man konnte davon träumen, dass sie an ihre eigenen großen Zeiten in den 1920ern wieder anknüpfen würde, an das Paris der Lost Generation, Sinatras New York oder Swinging London.
Wie albern einem das heute erscheint … Schon damals schwante mir relativ schnell, dass mein neuer Wohnort in Wirklichkeit verdächtige Ähnlichkeit mit einem riesigen Luftschloss hatte. Das Raumschiff Bonn war in eine Industriebrache kurz vor der polnischen Grenze versetzt worden, und in seinem Schlepptau fielen Horden junger Westdeutscher in die Stadt ein, die nun nicht mehr vor Wehrdienst oder spießigem Provinzlertum flohen, sondern die alten Ostberliner Arbeiterviertel in einen Abenteuerspielplatz verwandelten, auf dem sie – von Mami und Papi finanziert – Weltstadt spielen konnten. (Dem Vernehmen nach, ich bin da allerdings auf Hörensagen angewiesen, haben sie sich inzwischen in die berüchtigten »Mitte-Eltern« verwandelt, die jedem Lehrer, der ihren verzogenen Sprösslingen eine Vier zu geben wagt, mit dem Anwalt drohen.) Zeitgleich entdeckten englischsprachige Hungerkünstler und Rucksack-Bohemiens das Paradies von niedrigen Mieten und lockenden Ausschweifungen und zogen von Prag hierher, das nach 1989 kurzzeitig die Anwartschaft auf das neue Paris gehabt hatte. Leider lockten die Ausschweifungen wohl etwas zu stark – wie viele verheißungsvolle Musik‑, Buch- und Filmprojekte im magischen Dreieck zwischen Spätkauf-Bier, Görli-Dealer und Kit-Kat-Club versickert sind, weiß ich nicht, aber die Zahl dürfte Legion sein.
Trotzdem gab ich die Hoffnung zunächst nicht ganz auf. Was war mit den russischen Juden? Mit all den Talenten, denen es in der DDR verwehrt gewesen war, sich angemessen zu entfalten? Und gab es nicht doch internationale Künstler, die in die deutschen Hauptstadt gekommen waren und bedeutende Werke produzierten? Rufus Wainwright? Peaches? Joe Jackson? Nun ja. Der gute Rufus wohnt inzwischen wieder in New York, wer war gleich Peaches, und Joe wollte eigentlich nur in Ruhe abends in der Kneipe rauchen dürfen und nahm in Berlin ausgerechnet eine Platte mit Duke-Ellington-Songs auf. Auch ansonsten herrscht leider Funkstille: Es gibt keine großen Romane, die in Berlin der letzten fünfundzwanzig Jahre entstanden wären, keine bedeutende neue Musik, keine Kunst, die für irgendwen außer den üblichen Sammlernasen von Interesse wäre. Im Kino gab es ein paar interessante Ansätze, aber wie üblich im deutschen Film ist es bei diesen Ansätzen geblieben. Mitreißendes Fernsehen wird nur produziert, wenn der Produktionstross von Homeland in die Stadt einfällt. Und die stinkende U‑Bahn ist leider einfach nur eine stinkende U‑Bahn, die man irgendwann – man verzeihe mir den Kalauer – nicht mehr riechen kann.
Die jüngste Generation internationaler Hipster wird dem Augenschein nach von bleichen jungen Männern repräsentiert, die entweder wie Waldschrate oder wie Darsteller in 70er-Jahre-Pornos kostümiert herumlaufen, aber leider immer noch nichts von irgendeiner Bedeutung hervorgebracht haben. Beim derzeitigen Anstieg der Mieten muss man sogar fürchten, dass sie die Stadt allmählich wieder verlassen werden, und was bliebe dann? Deutschlands größte Uni- und Beamtenstadt mit angeschlossener Hartz-IV- und Integrationshölle. Und alles mit der für Uni- und Beamtenstädte üblichen Studententheater- und Subventionskultur. Ein einziger Grusel.
Damit ich nicht immer nur negativ bin: Bei Anna Durkes in der Graefestraße gibt es das vermutlich beste italienische Eis der Welt. Und in der Bio-Deli, die jetzt gegenüber von der Ackerhalle ihre Räumlichkeiten hat, kann man immer noch Pfister-Brot kaufen, das mit dem Nachtzug aus München importiert wird. Das immerhin vermisse ich ein bisschen.