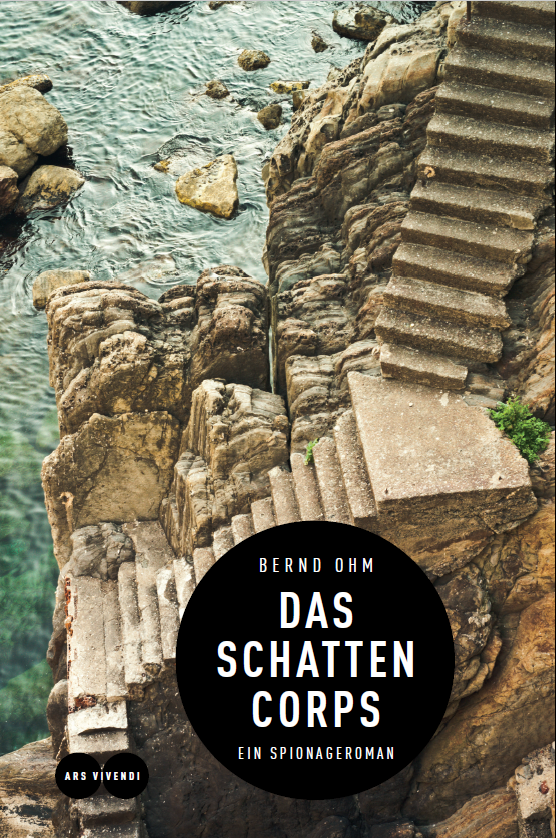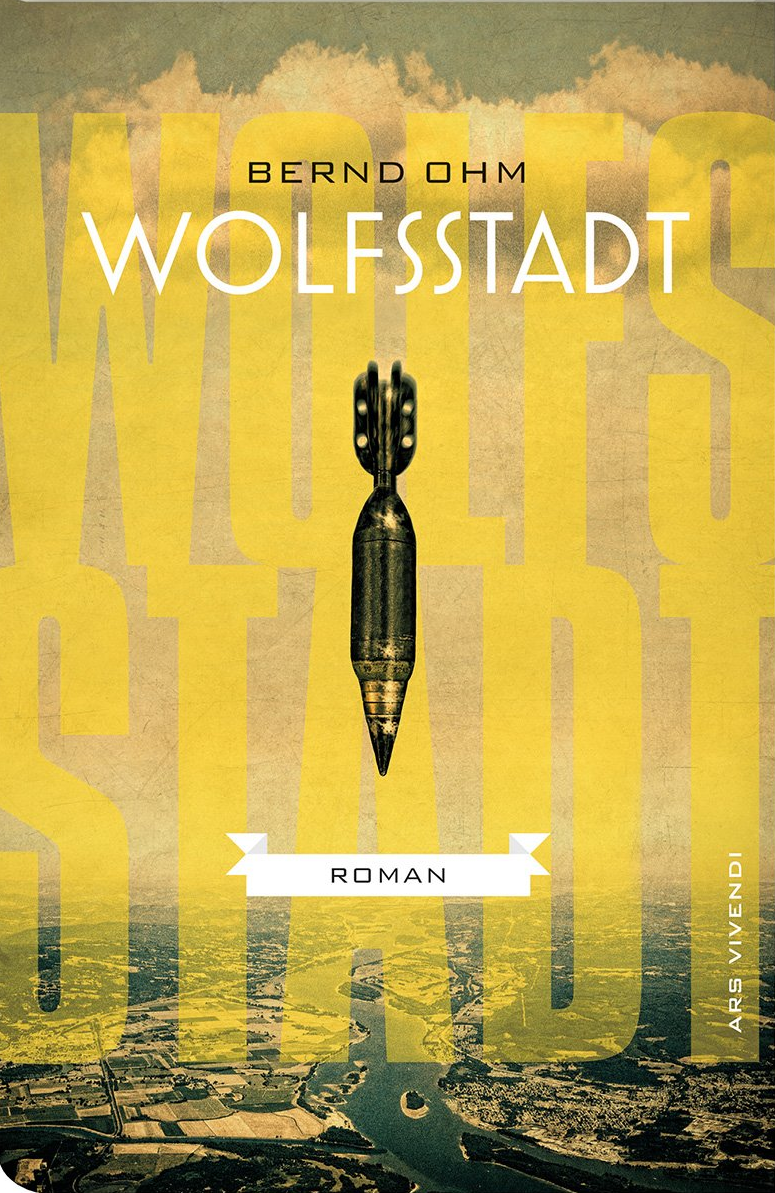Im letzten Post habe ich die Hoyaische Kirchenordnung von 1581 zitiert, in der unter anderem die »Meigreffschaften« verboten wurden. Es gab also offenbar auch in unserem kleinen, beschaulichen Dorf den in vielen Gegenden Deutschlands und Skandinaviens verbreiteten Brauch, jedes Jahr unter den jungen, unverheirateten Männern einen sogenannten »Maigrafen« zu wählen, der als Anführer des Pfingstumgangs (in der Kirchenordnung »Pfingstgilde« genannt) fungiert und – oftmals zusammen mit einer »Maigräfin« – auch den weiteren Festlichkeiten und Riten vorsitzt, die sich im Umfeld der Frühjahrsbräuche abspielen. Ein »Graf« ist er deswegen, weil er sozusagen den »König« vertritt, das heißt den Frühling selbst, der in dieser Zeit mit Macht ins Land kommt und die Geister der Vegetation antreibt, die wie jedes Jahr für neues Leben sorgen sollen.
Das Amt geriet irgendwann in Vergessenheit, nur den Pfingstumzug gibt es immer noch. Früher wurden dazu in der Nacht zum Pfingstsonntag junge Birkenbäume an die Häuser der unverheirateten jungen Frauen gelehnt und am folgenden Tag bei einem zeremoniellem Zug durchs Dorf rituell mit einem Eimer Wasser »begossen«, woraufhin der Wirt des jeweiligen Anwesens den Burschen eine Lage Bier oder Korn spendierte. Der Brauch ist in den letzten Jahrzehnten insofern etwas ausgeartet, als dass mittlerweile an jedes Haus eine Birke gestellt wird. Offenbar empfand man mit der Lockerung der Sitten ab den 1960er Jahren die alte Regel als nicht mehr zeitgemäß und sah gleichzeitig die Gelegenheit, in den Genuss größerer Mengen von Alkohol zu kommen, sodass nun nicht mehr jeder Pfingstumgang in völliger Ordnung sein Ziel erreicht und viele Bewohner dazu übergangen sind, den fälligen Obolus in Geldform zu entrichten.
Der Suff spielte zu Pfingsten allerdings schon früher eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Wie alten Gerichtsakten vom Ende des 17. Jahrhunderts, die das Landesarchiv aufbewahrt, zu entnehmen ist, war das Verbot von 1581 unwirksam geblieben, außerdem erfahren wir dort, dass früher zum Abschluss des Pfingstumgangs ein »Grafenbier« im Hause des Maigrafen stattfand. Im Jahr 1651 war das der Sohn eines Bauern, der seinen Hof genau in der Ortsmitte hatte (heute nicht mehr vorhanden). Den Aussagen der Zeugen zufolge wurde ordentlich gebechert, wobei sich vor allem der Sohn des hiesigen Pastors hervortat, der eigentlich nicht mehr im Dorf wohnte, sondern zu den Soldaten gegangen war und wohl über die Feiertage seine Eltern besuchte. Er prahlte mit seiner Pistole herum, die ihn als Kavalleristen ausweist (die Musketiere schossen damals in der Regel – und entgegen tausenden von Mantel-und-Degen-Filmen – mit dem Ding, nach dem sie benannt waren). Es kam zum Streit, und der junge Soldat wankte schließlich von dannen in Richtung Pastorenhaus.

Nach einer Weile verließen auch ein paar andere die Feier, die nicht weniger betrunken waren, darunter auch der frisch verheiratete Jungbauer eines der Nachbarhöfe. Brauch und Herkommen zufolge hätte er als Verheirateter eigentlich nicht mehr am Pfingstumgang teilnehmen dürfen und war wahrscheinlich nur aus alter Gewohnheit beim Grafenbier aufgetaucht, um beim Zechen nicht leer auszugehen. Die beiden Kumpanen, die ihn begleiteten, sagten später aus, das Grafenbier sei zu Ende gegangen, und man habe nicht so recht gewusst, ob es nun nach zu Hause gehen sollte oder irgendwohin weiterzechen. Wie dem man auch sein – man setzte sich in Bewegung und kam bald zum nahe gelegenen Kirchhof, an dessen Einfriedung man überraschend auf den Pastorensohn traf. Kaum wurde der Kavallerist der Neuankömmlinge gewärtig, hatte er auch schon seine Pistole gezogen und wollte in die Luft schießen.
Leider ging sein Püster nicht los – was bei den Stein- oder Radschloss-Schießprügeln der damaligen Zeit nicht ungewöhnlich ist, auf die anderen Zechbrüder aber genau den gegenteiligen Effekt des beabsichtigten hatte. Eine tiefenpsychologische Ferndiagnose spare ich mir hier, aber der Jungbauer lachte lauthals auf und verhöhnte den verhinderten Schützen, es gehöre wohl ein Becher Wasser oder Bier auf die Pistole, damit sie schießen könne. Der Soldat fühlte sich selbstverständlich in seiner Soldatenehre (und wo auch sonst noch) verletzt und spannte drohend den Hahn der Pistole erneut, um dem frechen Bengel zu zeigen, dass die Pistole sehr wohl schießen könne, der Jungbauer nahm dies als Aufforderung zum Kampf und stürzte sich auf den Kontrahenten, ein Gerangel entspann sich (wir wollen annehmen, dass die anderen beiden Zechbrüder den Kampf feixend kommentierten), und es kam, wie es kommen musste – ein Schuss löste sich und fuhr dem Jungbauern in den Leib, dass er hilflos zusammensackte.
Die Zeugenaussagen sind ein wenig wirr, aber danach ist der Täter wohl über den Zaun des Kirchhofs gesprungen und hat das Weite gesucht. Der Verwundete hingegen wurde auf seinen Hof gebracht, und man schickte nach dem »Balbierer« in Hoya (die Bartscherer waren damals nebenher als Wundheiler tätig), der aber nichts mehr retten konnte, denn nächsten Tag verstarb der Jungbauer unter starken Schmerzen. Die Akten sind leider nur bruchstückhaft überliefert, sodass nicht klar ist, ob der Täter später gefasst wurde oder sich gestellt hat; in jedem Fall hat er sich zwei Jahre später mit dem Argument verteidigt, alles sei nur zufällig so passiert und der Schuss habe sich von selbst gelöst. Auch das Urteil kennen wir leider nicht, können uns aber ausmalen, dass der volltrunkene Zustand der Zeugen zur Tatzeit nicht gerade dazu beigetragen hat, den Sachverhalt zu klären.
Und was lernen wir daraus? Ergibt sich ja eigentlich von selbst …