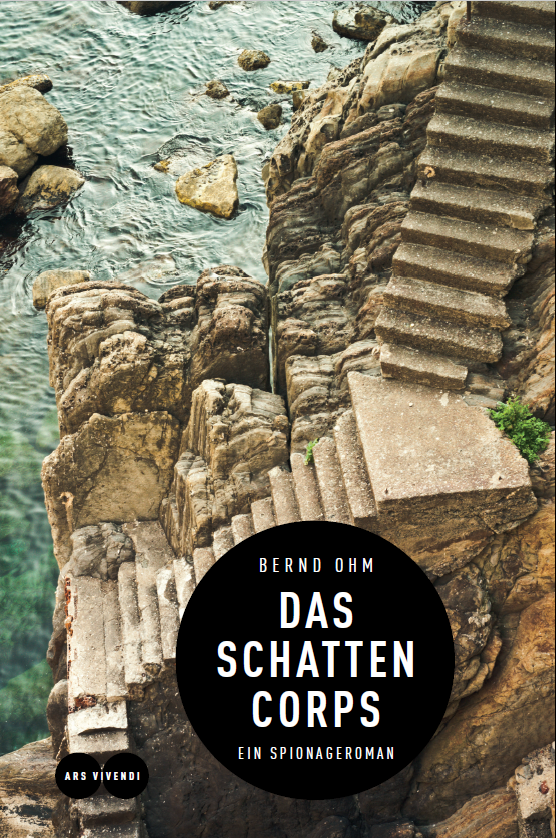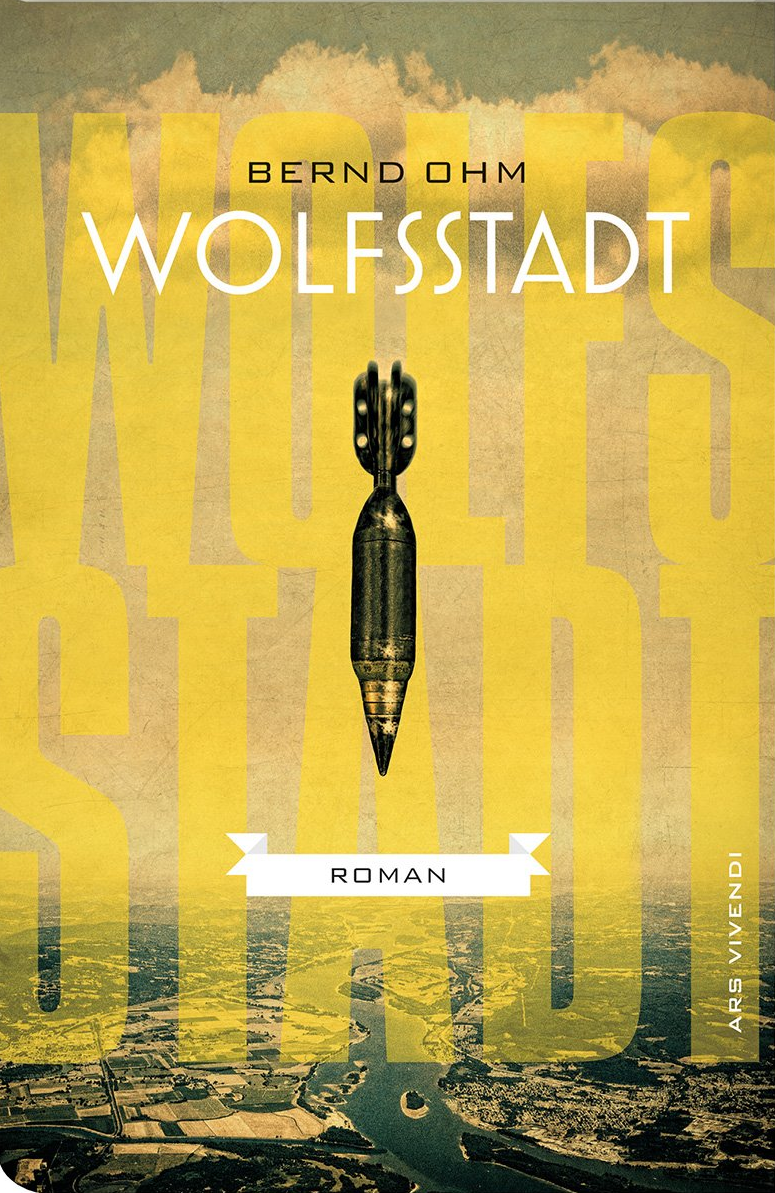Das Schlimmste ist, dass ich diesen Quark vermutlich auch noch selbst mit angesetzt habe: So etwa Mitte, Ende der 90er Jahre bastelte ich an einem Drehbuch über das Leben Klaus Störtebeckers herum, das seinerzeit diversen Münchner Film-Fuzzis unter die Augen kam und bei diesen für gewöhnlich die Frage provozierte: “Und warum läuft er am Ende nicht ohne Kopf an seinen Kameraden vorbei?” Weil ich kein Fantasy-Epos erzählen wollte, natürlich, sondern die tragische Passion einer Schar von Aufrührern, die an ihrer Zeit scheitern – so typisch deutsch wie Thomas Müntzer, die 48er Revolution oder die Bayerische Räterepublik. Am Ende gewann ich den Eindruck, dass sich diese Geschichte im derzeitigen deutschen Film- und Fernsehwesen nur als Kasperletheater erzählen ließe und beschloss, auf bessere Zeiten zu warten.
Umso größer war meine Überraschung, in der Vorankündigung des diesjährigen ARD-Osterprogramms einen groß angelegten, von der Münchner Bavaria produzierten Fernseh-Zweiteiler namens “Störtebeker” zu finden, dessen Inhaltsbeschreibung exakt dieses Kasperletheater erwarten ließ. Hatte mein heiß gekochtes Ferment seinerzeit doch irgendwelche Gärungsprozesse in Gang gesetzt? Würde ich einen Anwalt brauchen? Also Abendessen vorverlegt, die Kinder ins Bett gebracht und gemeinsam mit der Liebsten zwei freie Abende dem Dämon Glotze geopfert. Das Ergebnis? Die Leidensgeschichte war da – leider erlebte ich sie.
Zunächst die positiven Seiten: 1) Die Ausstattung war hübsch und zeigt, dass man auch mit schlappen 7 Millionen Euro ein ganz manierliches Bild der Epoche um 1400 hinbekommen kann. 2) Etwaige Ähnlichkeiten mit meinen Exposés haben sich, falls diese im Entstehungsprozess tatsächlich irgendeine Rolle gespielt haben sollten, so weit verflüchtigt, dass die Bavaria den langen Arm des Urheberrechts nicht zu fürchten braucht.
Jedenfalls von meiner Seite. Was die Rechteinhaber der Werke Willi Bredels angeht, eines 1964 verstorbenen, aus Hamburg stammenden Arbeiterschriftstellers, der sich in den 40er Jahren im Moskauer Exil einen Störtebecker-Roman mit dem Titel “Die Vitalienbrüder” ausdachte und diesen 1950 in Ost-Berlin veröffentlichte, wäre ich mir nicht so sicher. Bredel war Träger des DDR-Nationalpreises und später dort Präsident der Akademie der Künste, außerdem schrieb er Mitte der 50er Jahre das Drehbuch für “Ernst Thälmann – Kämpfer seiner Klasse”; ein Dissident war er also nicht gerade. Auch in ästhetischer Hinsicht gehen “Die Vitalienbrüder” aus heutiger Sicht ein wenig arg in Richtung trockene Agitprop, aber den Zuschauern des TV-“Ereignisses” vom vergangenen Wochenende dürfte doch die eine oder andere Einzelheit des Plots bekannt vorkommen: Bredels Störtebecker ist eltern- und heimatlos, er kämpft gegen einen bösen Patrizier und dessen noch böseren Sohn, er heuert auf dem Schiff eines guten Patriziers an, der unterdessen von dem bösen Duo abserviert wird und stirbt, an Bord muss er einen Zweikampf mit einem Muskelriesen bestehen, die Mannschaft meutert wegen der Ungerechtigkeit des Schiffsführers, das Schiff wird in “Seetiger” umbenannt (im Film: “Seewolf”) und segelt nun unter Störtebeckers Kommando als Kaperer, auf einer der aufgebrachten Koggen befinden sich lauter Ratsherren, die gefangen genommen, in Heringstonnen gesteckt und gegen Störtebeckers im Kerker schmachtenden besten Freund (im Film: seinen Bruder) eingetauscht werden, bei der Übergabe stellt sich heraus, dass dieser geblendet wurde. Erkennen Sie die Melodie?
Bei den restlichen Verwicklungen und Verstrickungen des Action-Melodrams haben sich dessen Macher (die offenbar zur Bernd-Eichinger-Schule der angewandten Zuschauerverachtung gehören, deren Credo da lautet: Wirkung vor Logik!) allerdings meilenweit von Bredels Vorlage entfernt, leider jedoch noch weiter von jeder historischen Wirklichkeit oder auch nur dramatischen Plausibilität. Die komplexe politische Lage der Jahre um 1400 – das schmerzt natürlich den Historiker – wurde bis zur Unkenntlichkeit entstellt: Eine hölzerne Gudrun Landgrebe als Dronning Margret von Dänemark kämpft angeblich dafür, zollfreien Zugang zu den Hansehäfen zu bekommen und stellt dafür den Seeräubern Kaperbriefe aus – in Wirklichkeit balgte sich die Dänen-Herrscherin damals mit Herzog Albrecht von Mecklenburg um den schwedischen Thron, wobei die Förderung des Kaperwesens von beiden Seiten ausging. Die Hanse und die Dänen hatten sich 30 Jahre vorher bekriegt, aber dabei spielten Freibeuter gar keine Rolle. Man kann das dauernde Gejammer im Film darüber, dass die Seeräuber den Handel zum Erliegen bringen, gar nicht ohne den Hintergrund der mecklenburgisch-dänischen Auseinandersetzungen verstehen, denn natürlich litt die Hanse als unbeteiligter Dritter am meisten unter der offiziell geduldeten Kaperei.
Und dann die Details! Stadttore dienen in “Störtebecker” offenbar nur dazu, dekorativ in der Gegend herumzustehen – geschlossen oder auch nur bewacht werden sie nie, und jedermann kann zu jeder Tages- und Nachtzeit die Stadt betreten … Die Männer tragen Stulpenstiefel, die erst Jahrhunderte später in Mode kamen, die Patriziertochter verlässt die Stadt mal eben so und vollemanzipiert in fremder Männerbegleitung für einen Ausritt (vollkommen undenkbar), der Patriziersohn benimmt sich wie ein spanischer Gockel aus dem Siglo de oro, das Kloster stammt ebenso wie die Takelage der Koggen offenbar aus derselben Epoche, der Gutshof von Störtebeckers Eltern steht mitten den Dünen (zweifellos ein frühes agrartechnisches Experiment), alle Seeleute können schwimmen (konnten sie nicht!), unbotmäßige Matrosen werden kielgeholt (ebenfalls erst ab dem Zeitalter der Stulpenstiefel üblich), ein Patrizier bereichert sich durch unrechtmäßige Aneignung eines Gutshofes (dabei galt auch früher: und ist der Handel noch so klein …), die Ehetrauung findet im Freien statt (die Patrizier waren seeehr stolz auf ihre großen, backsteinroten Kirchen) und und und. Ach ja, die einzige Hansestadt, die es jemals gab, heißt Hamburg. Alle Beschlüsse der Hanse werden im Hamburger Rathaus gefällt. Die Hamburger Ratsherren treten als Vertreter der Hanse auf, ohne mit anderen Städten Rücksprache zu halten. Das Hoch im Norden. Müssen wir Lübeck erwähnen, die “Königin der Hanse”? Die 70 Städte allein der Kernhanse im 14. Jahrhundert? Die großen Hansetage? Hier verabschiedete sich die reale Geschichte vollends ins Nirwana der Drehbuchphantasterei, und man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, irgendjemand hatte keine Lust, sich ins Thema einzulesen und wollte eigentlich ein Remake des “Roten Korsaren” drehen.
Insbesondere Kenner der nordeuropäischen Geographie mussten unter Kreuzfeuer der Drehbuchpeinlichkeiten leiden: Von Hamburg aus kann man offenbar locker einen Ausritt ans Meer machen, die alte und ehrwürdige Hansestadt Wisby auf Gotland wird zu einer Ansammlung von Piratenhütten eingedampft, Gotland selbst liegt irgendwo fernab von allen Schifffahrtsrouten und nicht mitten in der Ostsee (die Vitalier konnten sich auf Gotland wegen der mangelnden politischen Kontrolle während der dänisch-mecklenburgischen Kriegshändel festsetzen, nicht weil es eine unbewohnte Karibikinsel war!), von Hamburg segelt man mal so eben mir nichts, dir nichts nach Kopenhagen (anstatt nach Lübeck zu fahren und von dort zu segeln), und überhaupt gerät jede Fahrt zum Hochseeabenteuer, obwohl doch sogar im Film selbst erwähnt wird, dass man sich seinerzeit stets eng an die Küsten hielt. Eine einzige Tortur.
Was den Plot angeht, fassen wir uns kurz – dessen Maschen sind auch für Nicht-Fachleute ersichtlich so weit geknüpft, dass mühelos eine ganze Kriegskogge hindurch passen würde (um von der geballten Anhäufung unwahrscheinlicher Schicksalsfügungen gar nicht erst anzufangen). Ein Beispiel für viele: Warum, zum Henker, ergreift Gödeke Michels in der Auseinandersetzung mit dem Schiffshauptmann dramaturgisch völlig unvorbereitet für Störtebecker Partei und wirft sich mit seinem Schwert in Kampfpositur wie ein telepathisch gesteuerter Cyborg? Und schmeißt sein ganzes bisheriges Leben über Bord, um Pirat zu werden? Kismet? Erst zwei Minuten vor Schluss, als der Protagonist lehrbuchmäßig seinen Gegenspieler erledigt, die schöne Frau erobert und mit seinen Mannen die Stadt verlassen hatte, stellte sich so etwas wie Neugier ein: Wie wollte man in der verbleibenden kurzen Zeit von diesem glücklichen Ende schnell genug zur Hinrichtung auf den Grasbrook kommen? Man tat es mittels einer aufgesetzt wirkenden Off-Erzählung, die noch schnell den Tagesordnungspunkt “kopflos wankender Piratenhäuptling” abhakte und angesichts des vorangehenden glücklichen Endes in dramaturgischer Hinsicht so befremdlich wirkte wie die elektronischen Mätzchen, mit denen man sie am Schneidetisch aufgemotzt hatte. Man fragt sich kurz, wie Hamlet heute aussähe: Kurz vor Schluss heiratet er Ophelia, rächt seinen Vater, wird König von Dänemark und fällt schließlich in einem Epilog einem verschluckten Hühnerbein zum Opfer?
Immerhin scheinen die Schauspieler großen Spaß am Pirat-Spielen gehabt zu haben. Nach Herzenslust raufen und intrigieren, turnen und grimassieren, fechten und chargieren sie, was das Zeug hält. Dies war sicher umso schöner, als offenbar kein Regisseur in der Nähe war, der ihnen bei ihrem munteren Treiben Einhalt geboten hätte. Im Alter werden sie ihre Enkel auf den Schoß nehmen und von den Zeiten schwärmen, als das Augenrollen noch geholfen hat.
Und Störtebecker? Offenbar totally fit-for-fun und martial-arts-tauglich. Warum der Mann auf das gleiche Aufteilen der Beute bestand, warum er “Gottes Freund” genannt wurde, warum er nicht nur Fürsten, Prälaten und Pfeffersäcken, sondern der gesamten Welt den Krieg erklärte, warum er zum Freund des Volkes wurde – Pustekuchen, billige Klischees. Wohl wahr, aus dem Leben des norddeutschen Volkshelden ist außer sagenhaften Erzählungen nicht allzu viel bekannt (immerhin lautete sein Vorname in Wirklichkeit vermutlich “Johann” …), aber jede historische Fiktion muss sich doch zumindest die Aufgabe stellen, ein plausibel in seiner Epoche rekonstruiertes Leben wiederzugeben; was wir am Wochenende gesehen haben, war hingegen ein abstruser Kostümschinken mit der hierzulande seit jeher gängigen Mischung aus Brutalität, Sentimentalität und Klamauk, fernab jeder historischen Wirklichkeit und – noch schlimmer – Wahrhaftigkeit.
Am Ende bleibt eine bittere Erkenntnis: Wenn der deutsche Unterhaltungsfilm ganz bei sich ist, landet er offenbar unweigerlich in einer vollkommen künstlichen Welt voller holzschnittartiger Figuren, vorhersehbarer Entwicklungen und fader Witze – kurz: beim Karl-May-Film. Irgendwann in der Mitte des ersten Teils sagt mir meine Frau: Wenn du bei diesem Stuss mitgemacht hättest, würde ich dir jetzt aber den Kopf waschen. Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt.
(Hinweis: Dies ist die Originalversion eines Artikels, der zuerst 2006 in der jungen welt erschien. Er bezieht sich auf den Störtebecker-Zweiteiler, der damals in der ARD lief.)