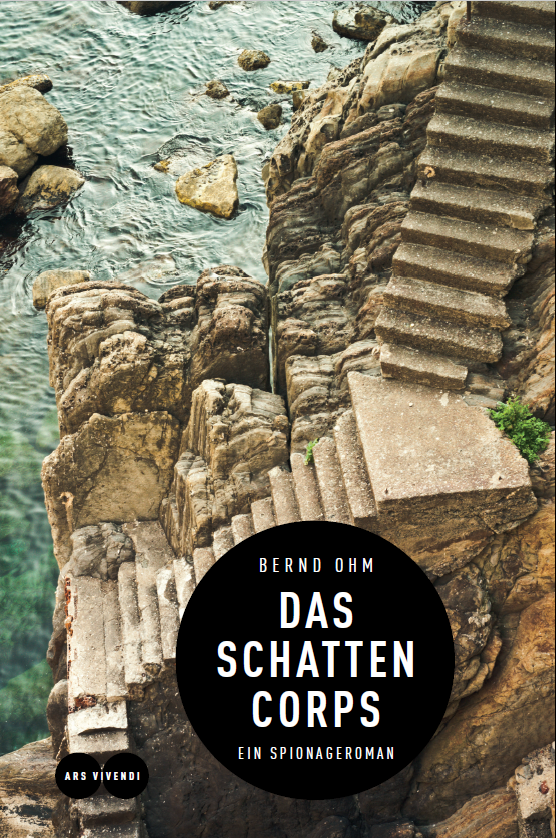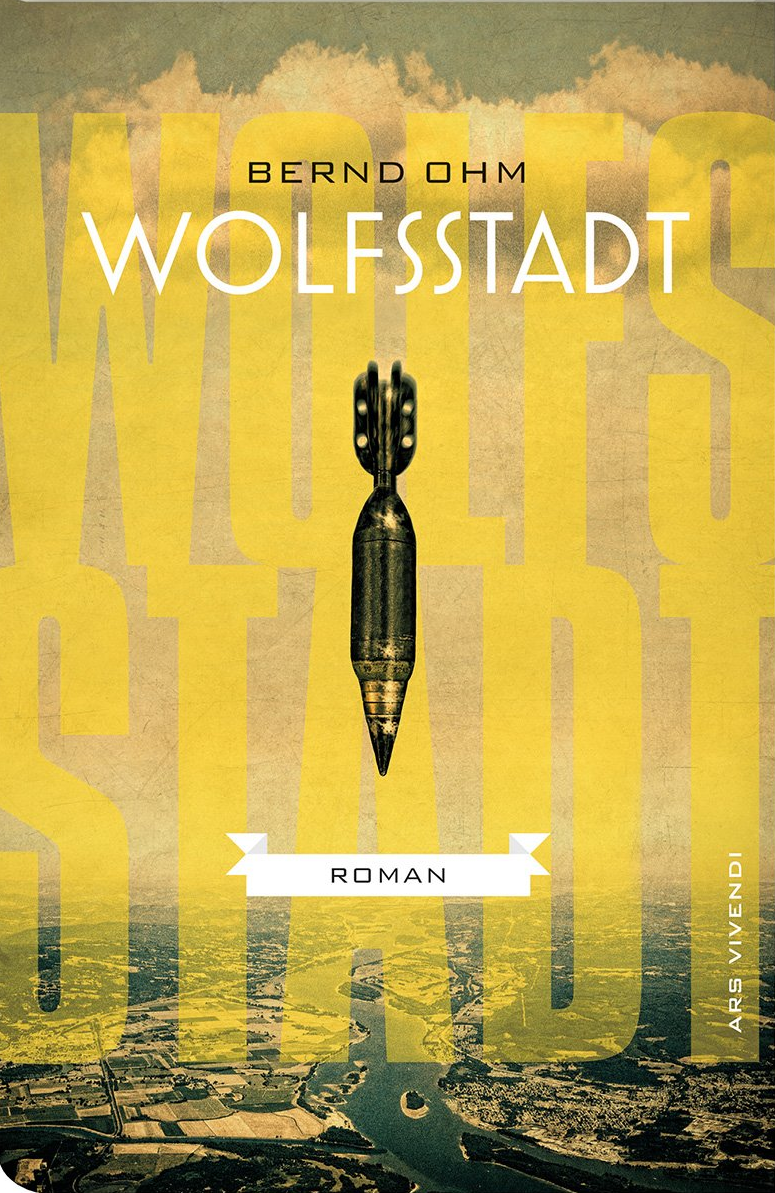Wenn man vor fünfzehn, zwanzig Jahren nach Portugal reiste, erwarteten einen dort Wunder, Mysterien und Magie: eine halb befremdliche, halb verführerische Welt voller träger Nachmittage in von der Neuzeit vergessenen Bergdörfern und Fischernestern, in denen die Sklaventrommel der industriellen Normzeit noch nicht so unbarmherzig den Takt vorgab wie zu Hause im ungemütlichen Norden; stille, leuchtend barockweiße Städte voll eigensinnigem Stolz und Wehmut nach den Zeiten Indiens und der brasilianischen Goldminen (nicht zu reden von der Hauptstadt, in der jede Nacht von Neuem die Naturgesetze ausgehebelt wurden); freundliche, sanfte und bemerkenswert un-spanische Menschen, deren Melancholie und geheime Maßlosigkeit man ergründen und staunend bewundern, aber niemals teilen konnte.
Kehrt man heute an die einstigen Sehnsuchtsorte zurück, findet man … den Heidepark Soltau. Dank einer ihre finsteren Machenschaften durchaus nicht im Untergrund betreibenden Verschwörung aus Brüsseler Bürokraten, ausländischen Großinvestoren und der üblichen Melange aus größenwahnsinnigen Lokalpolitikern, korrupten Beamten und spendablen Bauunternehmern vor Ort (man denke nur an die berüchtigte Expo ’98) verfügt das Land heute über großzügig ausgebaute Autobahnen und Landstraßen, ein dichtes Netz gruselig verkitschter Monumente von nationaler historischer Bedeutung und jede Menge auf einsame Strände geklotzte Spaßrutschen Marke “Erlebnisbad”. Davor jeweils ein riesiger Busparkplatz, mit Straßenlampen bestückt wie sonst nur die belgischen Autobahnen (und sicherlich ebenso wie diese aus der Erdumlaufbahn sichtbar) und drei große, verschiedenfarbige Container für die korrekte Mülltrennung. In farblich postmodern gehaltenen Einkaufszentren und Fußgängerzonen mit herzigem Kopfsteinpflaster und Waschbetonkübeln (nur dass darin Palmen stehen) sitzen junge Menschen im Café — in Lissabon seit neuestem in der weltweit ungefähr siebenhundertneunundsechzigsten Filiale des “Hard Rock Café” — und hören die gleiche Musik, tragen die gleiche, von MTV abgeschaute Mode und reden vermutlich denselben Unsinn wie ihre Altersgenossen in London, Berlin oder meinetwegen Warschau. Was bis vor kurzem noch eine Art universalistischer Verheißung war (“Alle Menschen sind gleich!”), erscheint heute eher als wahrgemachte Drohung. Und der Norden wirkt mit einem Mal wesentlich weniger ungemütlich.
Natürlich bin ich gerade ungerecht. Natürlich haben auch die Portugiesen das Recht, zu globalisierten Kleinbürgern zu werden und ihr Land in einen Themenpark namens “Portugal” zu verwandeln, wenn ihnen das in den Kram passt, natürlich sind sie mit denselben amerikanischen Filmen und Fernsehserien aufgewachsen wie wir, hören dieselben angloamerikanische Musik, träumen dieselben amerikanischen Träume; natürlich kann niemand von ihnen verlangen, den Eselskarren wieder anzuspannen, damit wir zivilisationsmüden Nord- und Mitteleuropäer ein paar pittoreske Fotos mehr aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen können; natürlich sollen sie keine Kultur aufrechterhalten, die sich auch durch weitverbreiteten Analphabetismus und den beständigen Zwang zur Emigration auszeichnete — aber: Haben sie denn in dieser schönen neuen Welt noch das, was man einmal “Seele” genannt hat, und das für kein Land wichtiger schien als für dieses?
Wir anderen haben ganz gewiss keine mehr. Wir haben das bisschen, was nach all den Katastrophen des 20. Jahrhunderts noch davon übrig war, vor Jahren schon an einen Mephisto im Siegfried-und-Roy-Kostüm verkauft, der uns mit dem einnehmenden Lächeln eines kalifornischen Gebrauchtwarenhändlers dafür den Traum von ewiger Jugend, Schönheit und der nie endenden Karriere als IT-Manager, Börsenjockey oder Rockstar aufgeschwätzt hat. Großen Widerstand haben wir ihm nicht geleistet, und die großen Träume und Utopien, bei denen es ja auch darum gegangen wäre, sich ein Stück dieser Seele zurückzuerobern, sind irgendwo auf dem Weg liegen geblieben, von den Schamanen einer neuen barbarischen Religion in den Schmutz getreten und verhöhnt, von jenen schamhaft beschwiegen, die einmal so glühend an sie geglaubt haben.
Jetzt also auch Länder wie Portugal. Oder Griechenland. Oder Irland. Oder welches Land Sie auch wollen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man noch Reisen im bestmöglichen Sinne der Wortes unternehmen konnte: als Sich-Einlassen auf die Fremdheit einer andere Landschaft, einer anderen Sprache, einer anderen Art, in der Welt zu sein. Wer reiste, dem öffnete sich, wenn er Glück hatte und es richtig anstellte, die Welt, dem eröffnete sich das Geheimnis des Lebens. Heute könnten wir vermutlich Estnisch oder Litauisch lernen und würden feststellen, dass auch im Baltikum im Jahre 12 nach dem Ende des sowjetischen Imperiums zumindest die Jugend vornehmlich damit beschäftigt ist, den neuen Harry Potter nicht zu verpassen, sich eine Meinung über “Matrix Reloaded” zu bilden, eine Fahrgelegenheit zur Love-Parade zu organisieren und — um sich das alles auch leisten zu können — einen Job zu ergattern, bei dem man in lässiger Aufmachung zwölf Stunden am Tag mit Kräuterbrause und belegten Teigfladen in der Hand vor dem Computer sitzt und elektronische Werbezettelchen entwirft (auch als “Webdesign” bekannt). Die Innenstädte ganz Europas gleichen sich in ihrer ahistorischen, aufgeputzten Kulissenhaftigkeit, die Vorstädte in ihrer monströsen Mischung aus riesigen Wohnmaschinen und putzigen Einfamilienhäusern, das platte Land in seinem albernen Wunsch, nicht mehr plattes Land zu sein, sondern glasglitzernde und stahlschimmernde Metropole. Wer heute reist, der findet wenig mehr als das eigene Spiegelbild.
Was haben wir dafür aufgegeben? An was können wir uns noch erinnern, das einmal zu uns gehört hat? Denn nicht nur der Schneeleopard und das Edelweiß können aussterben. Schon lange wird beklagt, dass auch die Sprachen immer weniger werden. Optimisten zufolge zehn Prozent, Pessimisten zufolge zwei Drittel aller 6000 auf der Erde gesprochenen Sprachen werden dieses Jahrhundert nicht überleben. Jede von ihnen ist eine ganze Welt für sich. Aber was nützen am Ende sogar unterschiedliche Sprachen, wenn man darin immer nur dasselbe sagen kann? Ihre Großeltern haben vielleicht noch den Dialekt des Landesteils gesprochen, aus dem sie stammten, Ihre Eltern immerhin richtiges Hochdeutsch. Sie selbst sind sicher stolz auf ihr gutes Englisch und realisieren jetzt, dass dieser Unsinn hier keinen Sinn macht, und wenn jemand Sie fragt, ob Sie okay sind, zucken Sie nicht zusammen, sondern antworten mit “Nicht wirklich”; wer weiß, wie es Ihren Enkeln gehen wird, mit ihrem “Master”-Abschluss an der “International University Kleinbobingen”, ihrer Stelle als “Chief Technical Officer” oder “Content Manager”, ihrem Leben in “Just in time”-Bereitschaft. Denn am Ende des historisch-ökonomischen Vorgangs, um den es hier geht, wird schließlich die gesamte Kultur dran glauben müssen, das Besondere, das Störrische, das Unverwechselbare, eben die Eigenart eines jeden Volkes und eines jeden Menschen.
Warum das alles so ist? Geben wir uns ein wenig idyllischer Nostalgie hin und hören wir, was zwei heute wenig populäre deutsche Philosophen vor 150 Jahren zum Thema zu sagen hatten:
Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. […] An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion.
Der Schuldige hieß damals “Bourgeoisie”, heute sagt man lieber “Globalisierung”, und Marx und Engels, diese verstaubten alten Knaben, die einem oft so überraschend heutig anmuten, waren seinerzeit der festen Überzeugung, dass diese Entwicklung eine nötige Vorbedingung für den Übergang der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit darstellen würde. Wenn wir den beiden also ein letztes Mal Glauben schenken wollen, müsste sozusagen erst auch die letzte neuguineischen Jäger-und-Sammler-Gemeinde eine Handy-Quote von knapp 100 Prozent aufweisen, müsste der letzte Angolaner im Gewerbegebiet Luanda-Süd bei IKEA ein “IVAR”-Regal und nachher bei OBI das Werkzeug zum Zusammenschrauben kaufen, müsste der letzte Allgäuer Anarchistenbauer den von den Vätern ererbten Hof versilbern und zu Telekom-Aktien machen, bis die Menschheit endlich bereit wäre für die Rückkehr ins Paradies. Oder, um uns für einen Moment wieder Portugal zuzuwenden: Deutsche Supermärkte, amerikanische Kaffeehäuser und schwedische Möbel, ebenso die von den heimgekehrten Gastarbeitern in den Norden des Landes importierte mitteleuropäische Haus- und Wohnkultur (Jägerzaun! Alpendach!) oder der Umstand, dass der Algarve neben Mallorca und der Costa del Sol ebenso zu einer Zweigstelle des deutschen Altenheimsystems geworden ist wie die Fischerdörfer und Korkeichenwälder des Südwestens eine Enklave kiffender Kreuz- und Prenzlberger Aussteiger darstellen, wären nur äußerer Ausdruck eines historisch notwendigen Prozesses, dem man sich besser nicht in den Weg stellt, weil er ohnehin nicht aufzuhalten ist.
Heute werden solche Weisheiten nicht mehr von der Kommunistischen Internationale, sondern vom Weltwirtschaftsforum in Davos verkündet. Werden sie dadurch glaubwürdiger? Anders gesagt: Wenn man auf einen Berg steigt und unterwegs ein Edelweiß findet, soll man es dann ausreißen, weil an dieser Stelle ja eine Seilbahnstütze einbetoniert werden soll? Wenn man den letzten Schneeleoparden findet, soll man ihn erschießen, weil man Angst hat, dass er die örtlichen Wege für Trekking-Urlauber gefährden könnte? Wenn man eine Sprache entdeckt, die niemand mehr spricht, soll man alle darin geschrieben Bücher zu Recyclingpapier machen, weil sie ja doch niemand mehr liest? Wenn man an sich selbst störrischen Eigensinn und hartnäckige Macken feststellt, soll man sie ausmerzen, um sich marktkonform auf dem Arbeitsmarkt anpreisen zu können? Sollen wir einfach nur dasitzen, die Hände in den Schoß legen und warten, bis es zu spät ist?
Man müsste klein anfangen, eine Rote Liste der bedrohten Nationaleigenschaften aufstellen; Greenpeace könnte neues Leben eingehaucht werden, indem die Organisation — die ja im Grunde ein zutiefst konservatives Anliegen vertritt — begriffe, dass auch der Kampf gegen die Globalisierung eine Form des Artenschutzes darstellt, dass scheinbar überkommene Formen der handwerklichen Produktion wie zum Beispiel eine simple Tischlerwerkstatt oder eine richtige, “altmodische” Schmiede mit Amboss und Funkenregen zu den Dingen gehört, deren Verlust unsere Welt nicht weniger verarmen lassen als das Aussterben einer südamerikanischen Käferspezies. Das gleiche gilt für englische Maßeinheiten, französische Lebenskunst (selbst Frankreich war schon mal französischer…), italienische Spontaneität, portugiesische Melancholie und, auch das, deutschen Fleiß und deutsche Gründlichkeit. Es gibt eine Ökologie der Kulturen, und sie befindet sich ebenso in der Defensive wie die der Arten.
Machen wir uns nichts vor: Die kapitalistische Produktionsweise mag ja allen anderen an Leistungsfähigkeit und Effizienz überlegen sein; vom Menschen versteht sie herzlich wenig. Und wird sie konsequent und marktliberal zu Ende gedacht, ist sie nicht weniger unmenschlich als Stalins zu Ende gedachte Aufklärung und Hitlers zu Ende gedachte Romantik. Lassen Sie uns auch diesem, vielleicht letzten, Totalitarismus entgegentreten und konsequent für die ewige Unzurichtbarkeit des menschlichen Wesens streiten! Stehen wir zu unseren Macken, zu unserer Faulheit, dem kleinen Quäntchen Irrationalität, ohne das wir nicht leben könnten, zu unseren obskuren Dialekten, die kaum jemand spricht, unserem abseitigen Musikgeschmack, der von EMI oder Bertelsmann nicht befriedigt werden kann, zu unserem hartnäckigen Festhalten an eine von den Vorfahren überkommen Landschaftsgestaltung und Bauweise, zu unserer Zugehörigkeit an diese oder jene ganz unverwechselbar eigenständige Gruppe von Menschen (Sie müssen sich nicht auf eine beschränken, aber Sie werden es nicht schaffen, zu keiner zu gehören), ganz allgemein zu unserem Festhalten am Alten, Hergebrachten, wenn uns das Neue nicht gefallen will. Und hören wir auf, über unsere französischen Nachbarn zu spotten, die wieder einmal viel klüger sind als wir und ungeachtet der allgemeinen Häme hartnäckig wenigstens versuchen, an ihrer Sprache und ihrer Kultur festzuhalten, und sei es mit so plumpen Mitteln wie dem einer “Chanson-Quote” im Radio. Die haben sich wenigstens noch nicht aufgegeben.
Die Alternative ist grausam: Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der lauter blonde, blauäugige, krankheitslose Menschenklone (Brad Pitt! Jenniffer Aniston!) in den funktional chromschönen Einkaufspassagen pastellfarbener Legolandstädte (Potsdamer Platz!) einen lockstoffhaft duftenden, nach allen Regeln der geschmackslaboratorischen Kaffeekunst gebrauten Latte Macchiato schlürfen und über die im Caféhaustisch eingelassenen Bildschirme gleichzeitig eine Konferenz mit Kapstadt abhalten, Abendkarten für eine Wiederaufnahme von “Evita” im Westend bestellen und die aktuellen Kurse ihrer Aktien an der Börse von Kuala Lumpur überprüfen. Später würden sie beim Italoinder eine Pizza Tandoori mit Algensalat essen und schließlich mit einem stromlinienförmigen, wasserstoffbetriebenen Sportwagen Zuffenhausener Bauart und Mailänder Design in die Berge draußen vor der Stadt schweben, wo sie in ihrem Landhaus im spanischen Stil im Angesicht der landschaftlichen Schönheiten der Krimhalbinsel und dank eines pränatal eingestellten und vollkommen optimierten Hormonhaushalts optimal vorbereitet auf eine Weise miteinander schlafen, von der wir noch nicht einmal träumen können. Wenn sie sich noch unterhalten, dann vermutlich in einer entfernt dem Englischen verwandten Stummelsprache (gibt’s jetzt schon: “Yo, man! Whassup?”). Abgesehen davon, dass einem schon der Instinkt sagt, dass solche Eloi sicher auch irgendwelche Morlocks bräuchten, die ihnen nötigenfalls mal das verstopfte Klo reinigen, wäre dies vor allem eins, nämlich die Selbstabschaffung des Menschen — in all seiner Zerbrechlichkeit und Unzulänglichkeit. Totalitarismus.
Große Worte, gewiss. Und wie sich gegen all das wehren? Wie Portugal wieder portugiesisch machen? Sie müssen, wie gesagt, nicht gleich Berge versetzen. Fangen Sie einfach mal damit an, Sie selbst zu sein. Der Rest ergibt sich dann ja vielleicht.
(Anmerkung: Der Text ist schon ein paar Jahre älter und berücksichtigt daher die Finanzkrise und alle seitherigen Entwicklungen nicht. Man könnte vom heutigen Standpunkt aus natürlich einwenden, dass die Gleichmacherei eben doch nur oberflächlicher Art war und die gravierenden Mentalitätsunterschiede zwischen den einzelnen Staaten Europas sich nicht so leicht beseitigen lassen wie in diesem Text befürchtet.)