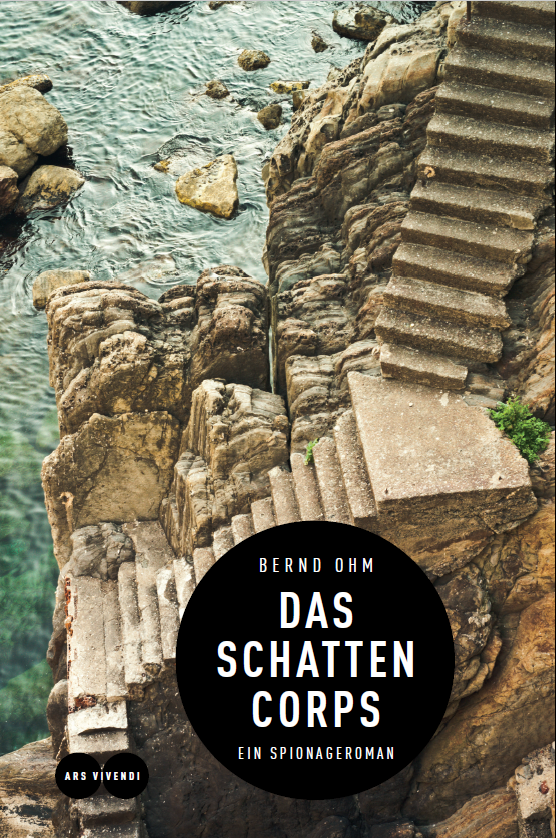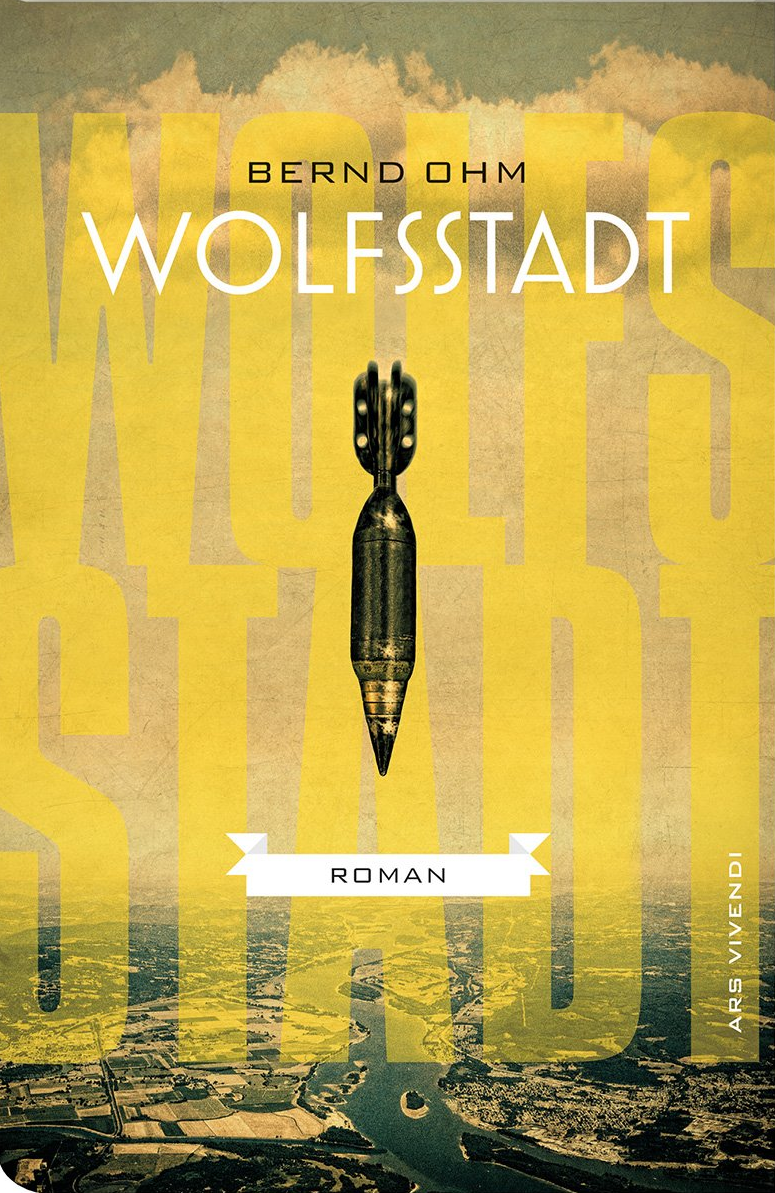Jeder kennt das: Der Rasen sieht aus wie ein Teppich. Die geharkten Wege drum herum verlaufen wie mit dem Lineal gezogen. Damit das Gras nicht über die Ränder wuchert, hat man es mit Spezialwerkzeug gestutzt und zur Sicherheit noch genau gleichmäßig den Rand des Sodens neben der Wegeinfassung abgestochen. Auf den Beeten findet sich nicht eine einzige verwelkte Blüte, dafür ist alles hübsch in Torf eingepackt, und an den schattigen Stellen kommt die chemische Keule zum Einsatz, um den Giersch auszumerzen. Passend dazu eine Gartenmöbelgarnitur, von deren ledernen Sitzflächen man essen könnte, und eine Hecke, die alle zwei Wochen mit der Nagelschere auf 1 Meter 55 gehalten wird. Im Herbst nicht ein einziges Blatt Laub. Und wenn doch, wird sofort die Höllenmaschine angeworfen, um es wegzublasen.
Warum macht man so etwas? Muss das sein? Ist das schön? Sicher, auch Hippie-Gärten brauchen Pflege, und dass der Giersch sich überall breit macht, ist nirgendwo gerne gesehen. Aber warum muss alles so geordnet und geometrisch sein? Was treibt Menschen dazu, viel Schweiß und Arbeit darin zu investieren, jedes bisschen Lebendigkeit aus ihren Gärten zu vertreiben?
Gut, sagt ihr, das sind Spießer, und Spießer sind eben so. Aber da macht man es sich in bisschen leicht. Was ist das schließlich überhaupt, ein Spießer? Und warum mag er keinen Wildwuchs? Er könnte sich ja vor den Fernseher hängen (ja, es handelt sich meist um ältere Zeitgenossen), ein Bier aufmachen und in Ruhe das Gras wachsen lassen. Was stört ihn daran?
Und was mag er da in Wirklichkeit nicht? Gehen wir in der Zeit zurück, ein paar hundert oder tausend Jahre. Da gab es noch wirkliche Wildnis, riesige Wälder voller gefährlicher Tiere und wild wuchernder Natur. Und dann kamen Leute mit Steinäxten, später waren sie aus Metall, und fällten Bäume, bauten aus dem Holz und Lehm geometrisch sauber geordnete Strukturen, in denen sie lebten, und teilten das gerodete Land in viereckige Stücke, auf denen Sie Bohnen oder Einkorn anbauten und die sie mit Flechtzäune gegen das im Wald weidende Vieh und freche Rehe schützten. Jedes eingezäunte Stück Land war ein Sieg über die Natur, die das Menschentier in seiner Inkarnation als Jäger und Sammler nur recht dürftig an ihren Schätzen teilhaben ließ. Gerade Linien sind praktisch, um beim Pflügen nicht die Orientierung zu verlieren, und wer sein Gemüse von Wildkräutern überwuchern lässt, wird im nächsten Winter Probleme haben, an ausreichend Vitamine zu kommen.
So weit, so gut. Aber, so sagt ihr zu Recht, das gilt heute doch gar nicht mehr. Draußen, jenseits des Gartenzauns erstreckt sich keine wuchernde Wildnis, sondern ein ebenso geometrisch geordnetes Ackerland, auf dem hektarweise öde Monokulturen aus Raps, Weizen oder Mais aneinandergereiht stehen. In Deutschland gibt es nicht ein einziges Flecken Erde, dass dem Gestaltungswillen des Menschen entkommen wäre, sogar “Nationalparks” muss man einrichten und so ummodeln, dass sie aussehen wie der Urwald, von dem die Städter träumen. Und trotzdem wird der eigene Garten gehegt und gepflegt, als gelte es immer noch, die böse Natur im Schach zu halten, die einem die Früchte schweißtreibender Feldarbeit wegnehmen will. Haben sich die Leute nur irgendwie im Jahrhundert geirrt oder können einfach nicht von alten Gewohnheiten lassen?
Die Antwort dürfte tief in den dunklen Geheimnissen der deutschen Seele, ja der Seele des Europäers schlechthin verborgen liegen. Nein, ich komme jetzt nicht mit Freuds analer Phase und Adornos autoritärem Charakter. Sehen wir uns lieber an, was C.G. Jung in Traum und Traumdeutung über die Beziehung des Unbewussten zur Natur zu sagen hatte:
Wir haben keine Buschseele mehr, die uns mit einem wilden Tier identifiziert. Unsere direkte Kommunikation mit der Natur ist zusammen mit der damit verbundenen beträchtlichen emotionalen Energie im Unbewussten versunken.
Sollte der Garten des Grauens also eine Art unbewusster Kommunikation mit der Natur sein? Noch zentraler ist hier wohl der Vorgang der Projektion: Die Inhalte des Unbewussten können wir direkt nicht erfassen (sonst wäre es ja nicht unbewusst), sondern nur auf dem Wege der Projizierung dieser Inhalte auf die Objekte der Außenwelt. Diese Projizierung funktioniert ganz automatisch, und sie funktioniert deshalb, weil es irgendetwas in dieser Außenwelt gibt, das über eine assoziative gedankliche Verknüpfung mit einem Inhalt der unbewussten Psyche parallel gesetzt werden kann.
Was aber finden wir, wenn wir tief in das Unbewusste des abendländischen Christenmenschen ebenso wie in das seines atheistisch-aufgeklärten Vetters schauen? All jene mühsam verdrängte Wildheit, Grausamkeit und Unbändigkeit, die wir traditionell der “Natur” zuschreiben (mit historisch durchaus guten Gründen, siehe oben), und die vom Christentum zu den Werken des Satans gezählt, von der Aufklärung aber in die Schmuddelecke des Asozialen verwiesen wird – mit jeweils ähnlichem Resultat. C.G. Jung zufolge ist das große Problem der europäischen Kultur die fehlende Integration dieses “Schattenarchetyps” in die Gesamtpersönlichkeit, d. h. die einseitige Betonung des Christusvorbilds, das noch im Ideal des aufgeklärten Menschen weiterwirkt, der sich Technik und Naturwissenschaften bedient, um die Welt seinem Willen zu unterwerfen. Ein voll entwickeltes “Selbst” kann erst entstehen, wenn der Schatten im Verlauf einer Individuation bewusst und zum akzeptierten Teil der Persönlichkeit wird – ohne diese zu beherrschen und ohne die Fähigkeit des Menschen zum Leben in Gemeinschaft mit anderen zu beeinträchtigen.
Das ist natürlich eine schwierige Kunst, die der Psyche einiges an Energie abverlangt (“Es muss allerdings anerkannt werden, daß man nichts schwerer erträgt als sich selbst.”, C.G. Jung: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten, Zweiter Teil, Die Individuation, S. 110), und so verwundert es nicht, dass man den ganzen Plunder am liebsten einfach in den Keller trägt, mit göttlichem Beistand die Tür zum Aufgang verrammelt und hofft, ihn dadurch loszuwerden. Was natürlich niemals gelingt.
Denn der Schatten klopft sofort wieder an der Vordertür an und will herein, diesmal aber nicht als offensichtlicher Teil der eigenen Persönlichkeit, sondern in Gestalt des machtlüsternen Ausländers (die eigene Machtlust!), des habgierigen Juden (die eigene Habgier!), des geizigen Kapitalisten (der eigene Geiz!) oder eben in Form der wild wuchernden Natur, die man unbedingt in Schach halten muss, um die eigene Wildheit nicht anerkennen zu müssen. So wird doch auf recht einfache Weise ein Schuh draus – der Garten Eden in der westlichen Tradition ist nun mal ein Garten, kein Urwald. Man findet diese Mentalität nicht zufällig besonders ausgeprägt in den protestantischen Gebieten, wo der Kampf mit dem Teufel bekanntlich im eigenen Gewissen ausgefochten werden muss, während man katholischerseits wie üblich ein bisschen g’schlamperter sein kann, weil man’s in der Beichte dann ja eh wieder loswird.
Wie diese Mentalität in den letzten zweihundert Jahren die Umwandlung Deutschlands in die wohlgeordnete Ödnis unserer Gegenwart vorangetrieben hat, wird eingehend – wenn auch ohne die Bezugnahme auf das Unbewusste und die Analytische Psychologie – in dem sehr erhellenden Buch Die Eroberung der Natur: Eine Geschichte der Deutschen Landschaft des britischen Historikers David Blackbourne beschrieben. Wir sehen hier in dem Spiegel, den uns ein ausländischer Wissenschaftler vorhält, all jene “großen Projekte”, mit denen die Deutschen ihre Natur unterworfen haben – von der Begradigung des Rheins durch Tulla über die Trockenlegung des Oderbruchs und die Eindeichung der nordwestdeutschen Seemarschen bis hin zu den Kultivierungsprojekten der Nazis im besetzten Osteuropa. Zwar sahen einige Zeitgenossen auch den enormen Verlust an Biodiversität, den etwa Theodor Fontane am Beispiel des Oderbruchs als “Vernichtungskrieg gegen Wildbret und Geflügel” bezeichnete, aber viel wichtiger ist das Gefühl der neuen Siedler und ihrer Nachkommen, nun in einem “Paradies” zu leben (das dann im Fall der Gebiete östlich der Oder nach 1945 zu einem “verlorenen” Paradies wurde), das von Menschenhand in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan geschaffen worden war.
Zwangsläufig konnten Vertriebenendichter wie Agnes Miegel die Abtretung der Heimat an Polen und die Sowjetunion auch nicht anders sehen als unter dem Vorzeichen einer vorgeblichen Rückkehr der Wildnis:
O kalt weht der Wind über leeres Land,
O leichter weht Asche als Staub und Sand!
Und die Nessel wächst hoch an geborstner Wand,
Aber höher die Distel am Ackerrand!
Früher aber:
Da wogte der Roggen wie See so weit,
Da klang aus den Erlen der Sprosser Singen
Wenn Herde und Fohlen zur Tränke gingen,
Hof auf, Hof ab, wie ein Herz so sacht,
Klang das Klopfen der Sensen in heller Nacht,
Und Heukahn an Heukahn lag still auf dem Strom
[…]
Garbe an Garbe im Felde stand.
Hügel auf, Hügel ab, bis zum Hünengrab
Standen die Hocken, brotduftend und hoch,
(Agnes Miegel, Es war ein Land)
Hier klingt das Bild einer wohlgeordneten, grünen Kulturlandschaft an, die der wilden Natur abgerungen wurde, und die nun wieder, unter sowjetischer Herrschaft, in den Zustand der wilden, zügellosen Natur zurückkehrt, der die deutschen Siedler einstmals Einhalt geboten hatten.
Das also ist das anfangs beschriebene Spießerglück: ein Garten Eden, aus dem alles Böse und Wilde vertrieben wurde und dessen Grenzen ständig gegen den Wiedereinfall der verdrängten Dämonen des eigenen Unbewussten verteidigt werden müssen. Himmel hilf den armen, verlorenen Seelen! Jungs großes Projekt der Individuation und der Integration des Schattens ist so nötig wie eh und je, und mit jedem Tag wächst die Sehnsucht nach Wildnis.
Trotzdem muss ich jetzt mal raus und das Auslegerwirrwar im Erdbeerbeet beseitigen. Man muss halt irgendwie die Balance finden…