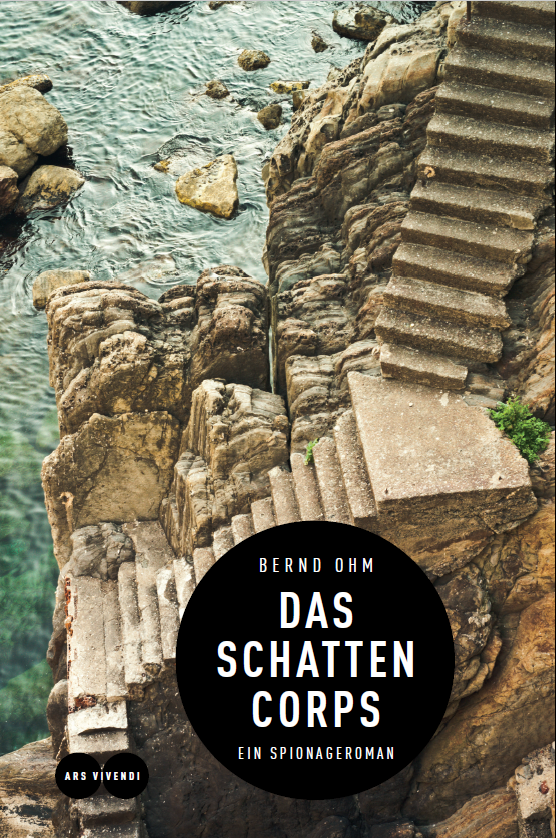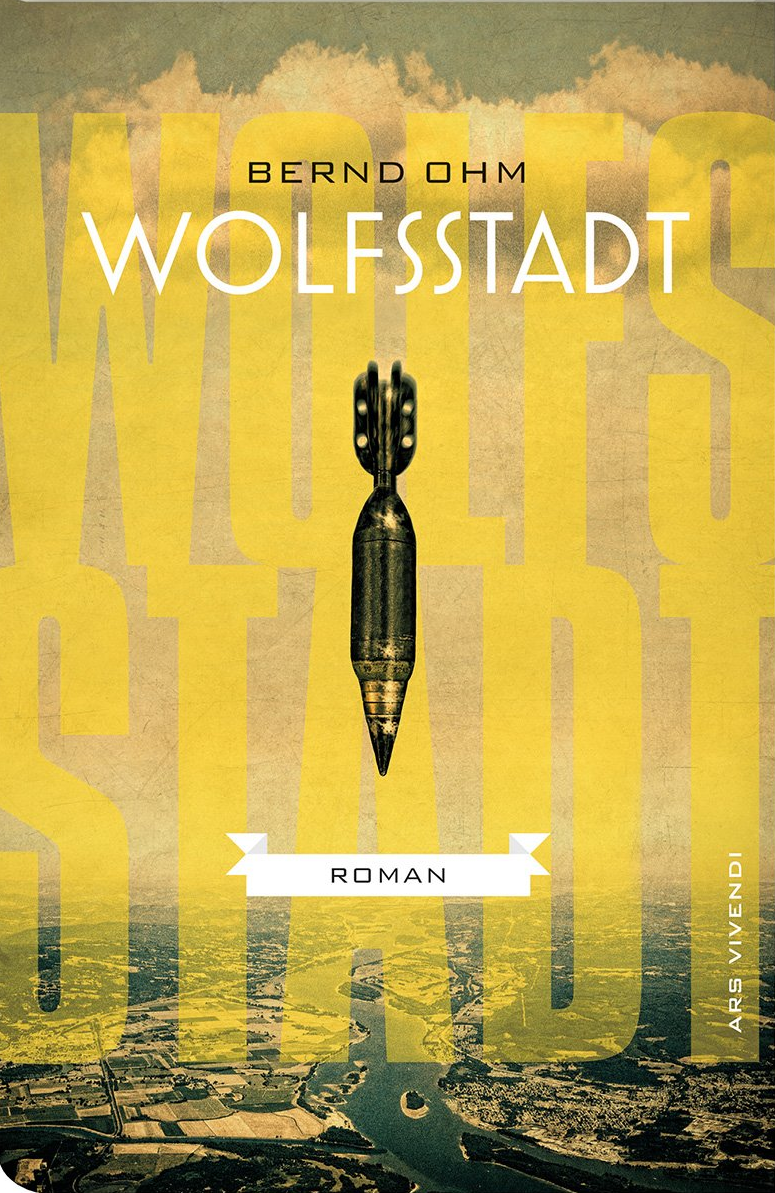Ich habe mich in jungen Jahren recht ausgiebig mit Rucksack und Reiseschecks ausgerüstet in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten umgetan. Oft waren es Weltgegenden, die als nicht besonders sicher galten und dies auch tatsächlich nicht waren. Ich hatte immer Glück – der Überlandbus derselben Linie wurde erst am Tag nach meiner Fahrt ausgeraubt, der Raubüberfall auf das Beachvolleyball-Spiel geschah meinen zeitweiligen Mitreisenden, nicht mir, der Taschendieb suchte sich den Mann aus, der vor mir durch die Fußgängerzone Rios schlenderte. Sogar die Hoodlums, die mich in St. Louis auf dem Weg vom Baseballstadion zur Unterkunft dumm anquatschten und „untersuchen“ wollten, gaben sich schließlich mit ein paar blöden Sprüchen zufrieden, weil sie den unverhofft in ihrem Kiez aufgetauchten Deutschen so ulkig fanden.
Man wusste auch bis zu einem gewissen Grad, wie man sich schützen konnte: in alten Klamotten herumlaufen (meine Standardkluft: alte Bundeswehrhose, schmutzige Segeltuchschuhe, schlabbriges Polohemd), einen Geldgürtel tragen, die Landessprache beherrschen. Nachts nicht an roten Ampeln halten, auf keinen Fall unbegleitet in die Favela. Nicht auf Gespräche mit komischen Leuten einlassen, die einem in der Baixa von Lissabon Drogen und goldene Armbanduhren verkaufen wollen. Und vor allem wusste man, dass all diese Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr nötig sein würden, sobald man in München oder Berlin wieder das Flugzeug verlassen hatte. Das eigene Land war ein bisschen langweilig, man war nicht sonderlich stolz darauf, die Leute rannten zu sehr dem Geld hinterher, und kulturell gaben einem New Orleans und Bahia alles, was man brauchte. Aber eines war dieses Land ganz bestimmt: sicher und verlässlich. Weiterlesen