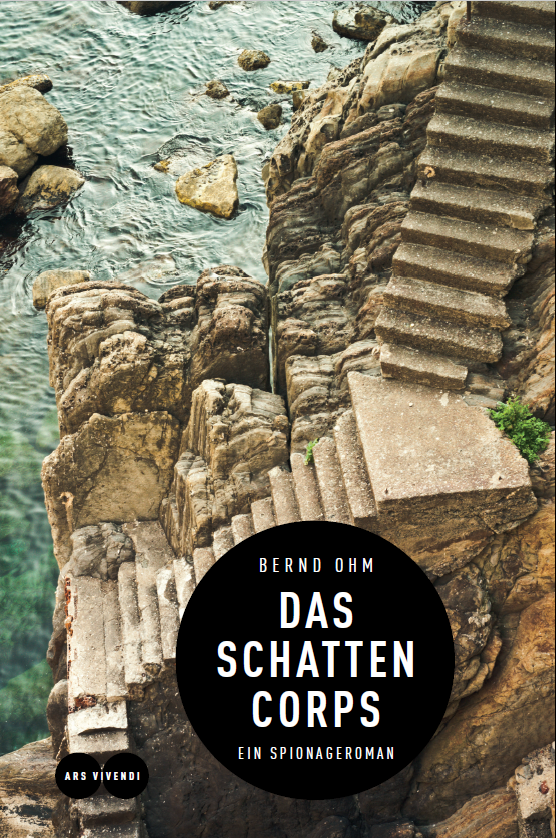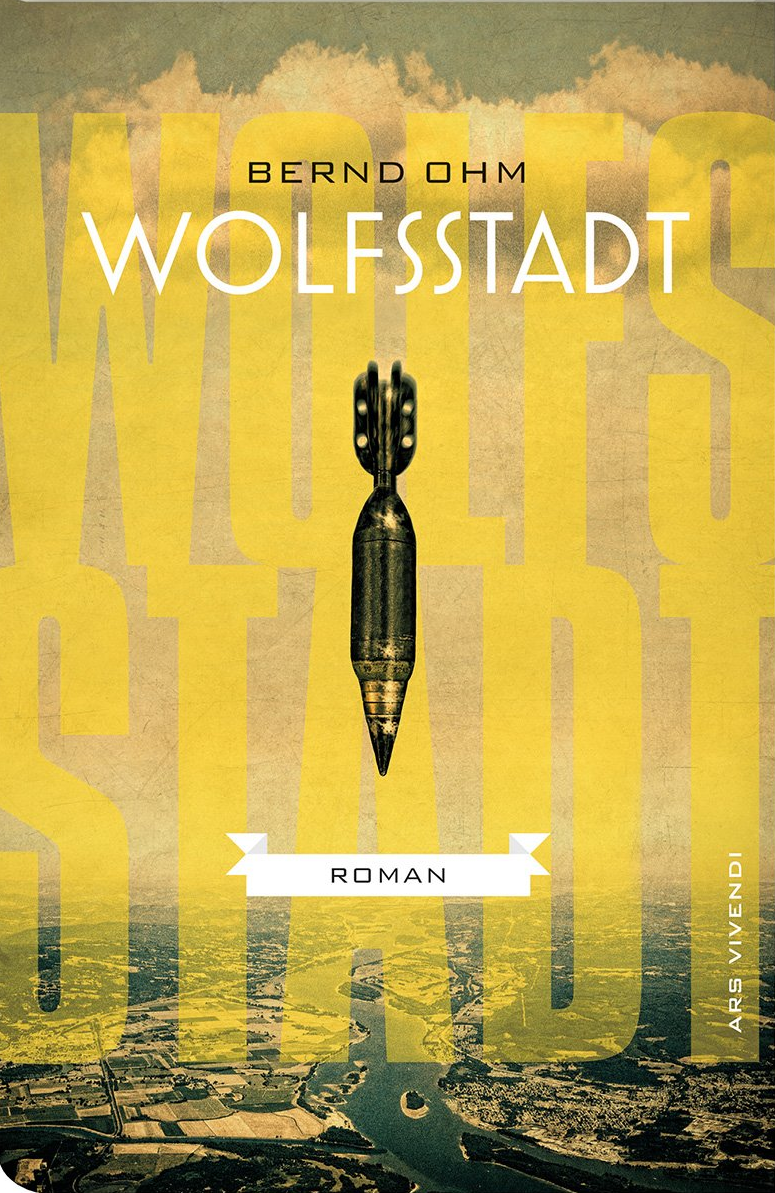Der beste Zen-Lehrer wäre einer, der noch nie etwas von Zen gehört hätte. Und Lehrer wäre er auch nicht.
Mein Freund Thom jedenfalls war so eine Art Hausmeister. Und immer durstig. Wenn ich frühmorgens lauthals gähnend aus meinem Bungalow kam, um durch ein paar Schwimmzüge im nahen Meer die Nacht aus meinen Gliedern zu verscheuchen, hatte er schon zwei oder drei von den kleinen, braunen Fläschchen mit Reisfusel geleert, die so billig waren, dass auch ein einheimischer Arbeiter damit seinen Schnapsdurst löschen konnte, und kehrte verdächtig gut gelaunt, aber aus allen Poren schwitzend Laub und Sand von den Wegen oder holte umständlich mit einer langen Bambusstange frische Kokosnüsse von den Palmen – wir Gäste hatten es gerne aufgeräumt und wollten später zu Hause vom baumfrischen Saft schon zum Frühstück schwärmen können … Nach dem Mittagessen sah man ihn dann öfter in seiner Hängematte liegen als irgendwelchen Pflichten nachgehen (oder gar richtig arbeiten), und pünktlich jeden Tag um fünf setzte er sich auf sein altes Moped und knatterte an die Hauptstraße, wo sich an einer aus Palmblättern, Plastikflaschen und Bauschutt zusammengehauenen Schnapsbude die örtlichen Trinker zu versammeln pflegten, um lautstark die Geschäfte der Welt erst zu bereden und dann in einem ausgewachsenen Rausch zu ersäufen.
Thom verlor aber weder bei diesen abendlichen Geheimratssitzungen noch zu sonstigen Gelegenheiten jemals die Kontrolle über sich. Er torkelte nicht haltlos herum, belästigte die weiblichen Gäste nicht, stritt sich nicht mit den männlichen und konnte mühelos weit jenseits jeder Promillegrenze den hauseigenen Pickup nach Naathon steuern, um Einkäufe zu erledigen oder beim Fähranleger neue Gäste abzuholen – und das, ohne auch nur den Mittelstreifen zu überfahren. Nur beim Weihnachts-Barbecue, dass extra für die ja eigentlich gerade davor geflohenen Gäste aus dem Westen veranstaltet wurde, vergaß er sich ein wenig und sprach dem Rumpunsch derart heftig zu, dass er den ganzen Abend über allen auf den Rücken haute und landesuntypisch laut grölend “Melly Chlistmas” wünschte, was ihm aber von niemandem übel genommen wurde, denn alle hatten ihn gern. Und als er eines Abends eine Gruppe von uns auf den besagten Pickup lud und wir zusammen eine feucht-fröhliche Nacht im Reggae-Pub in Chaweng verbrachten, musste auf der Rückfahrt Göran aus Schweden das Lenkrad übernehmen, weil Thom darüber einzuschlafen drohte.
Niemand wusste so richtig, womit er seinen schnapsseligen Lebenswandel überhaupt finanzierte. Seine Frau Dhin arbeitete in der Küche der Bungalowanlage, und sie passte wie ein Schließhund auf, dass ihrer beider Lohn nicht in der Trinkbude an der Hauptstraße oder den Girlie-Bars von Chaweng landete. Thom bekam ein kleines Taschengeld von ihr, dass aber nie und nimmer für das schätzungsweise gute Dutzend braune Fläschchen ausreichte, deren Inhalt jeden Tag seine durstige Kehle hinunter rann, also ging die allgemeine Vermutung, dass die kleinen Plastiksäckchen voller Marihuana, die er manchmal aus – so sagte er jedenfalls – Gefälligkeit für bestimmte Gäste von einem Freund besorgte, der in den Bergen eine größere Plantage betrieb, nur die Spitze eines Eisbergs von professionell betriebenem Drogenhandel bedeutete, und der wäre dann seine eigentliche Einnahmequelle. Vielleicht stimmte das, vielleicht auch nicht; mir schien, es hätte zu viel Arbeit bedeutet.
In jedem Fall – nicht gerade ein Bodhisattva, mein Freund Thom … Auf den ersten Blick jedenfalls. Auf den zweiten, für den man eine Weile brauchte, stellten sich die Dinge schon ein wenig anders dar: Als ich einmal mein in der Khao San gekauftes Che-Guevara-T-Shirt zum Trocknen an die Wäscheleine hängte, krähte Thom laut: “I like dis man!” und pries den Helden der Sierra Maestra so lange und derart kenntnisreich in den höchsten Tönen, dass ich ihm das T‑Shirt schließlich schenkte und er es daraufhin bis zu meiner Abreise nicht mehr auszog. Bei einer anderen Gelegenheit zeigte er sich gleichermaßen bewandt in Fragen der europäischen Geschichte und erläuterte seine Sicht des großen Helden “Napoli”, der die Errungenschaften der glorreichen Französischen Revolution über ganz Europa verbreitet hätte. Wir stritten uns fast deswegen.
Vollends unerwartet traf mich dann seine eher nebenher gemachte Bemerkung, er sei früher drei Jahre als Mönch durch die Klöster des ganzen Landes gezogen. Ich hatte ihn von meinem Plan erzählt, in dem Wat auf der Nachbarinsel eine Einkehr mitzumachen, aber Thom winkte nur ab:
“You must go to Wat Suan Mokh, it is de best … !”
Es war schwierig, einem Menschen, der so vollkommen in der Gegenwart lebte wie er, weitere Einzelheiten über seine Vergangenheit zu entlocken, aber an all den Nachmittagen, die er auf meiner Veranda in der Hängematte lag und mir grasrauchend beim Gitarrespielen zuhörte, kam doch die eine oder andere kleine Geschichte zu Tage: Er stammte demnach aus der Gegend von Surat Thani, wo seine Familie immer noch lebte, war aber schon in jungen Jahren ausgerissen und hatte sich auf die Suche begeben, zuerst nach der großen, weiten Welt, dann nach der Buddhaschaft. Er und Dhin hatten eine Tochter, die in Bangkok im Internat lebte und später auf eine gute Universität im Ausland gehen sollte. Für dieses Kind sparten sie all ihr Geld und lebten selbst in einer mehr als schäbigen Bambushütte, die Thom eigenhändig und eventuelle gesetzliche Hindernisse souverän ignorierend auf einem verfallenen Baugrundstück errichtet hatte, dessen Investor pleite gegangen war. Früher war er auch einmal in Kanada gewesen und hatte bei der Apfelernte gearbeitet (in einer anderen Version bei der Marihuana-Ernte), daher sprach er so gut Englisch, und in ein paar Jahren, wenn die Tochter studieren würde, wollten er und Dhin eine große Weltreise unternehmen, um endlich einmal mit eigenen Augen zu sehen, wo denn all die Freunde wohnten, die sie im Lauf der Jahre auf Samui gewonnen hatten.
Über Thoms Zeit als Mönch erfuhr ich wenig mehr, als dass man im Wat Suan Mokh, das ist Thailändisch für “Garten der Befreiung”, Gehmeditation betrieben habe – “You know, we did de walking-walking and only tink de walking-walking …” – und es sich bei dem Kloster, aber das wusste ich ja schon, um das beste ganz Thailands handelte. Manchmal hielt er auch beim morgendlichen Kehren der Wege inne, blickte auf die weite Bucht von Maenam und sagte unvermittelt “I must do de meditation again” oder “Dis place has lot of hahmony” oder sogar “Before, not so many houses”.
Und dann erfuhr ich noch von dem Buch. Thom hatte mir ein paar Tage vor meiner Abreise einen kleinen, von ihm selbst aus einem Bambusrohr und Kerzenwachs angefertigten und mit roter Farbe bemalten Didgeridoo geschenkt. Die Bemalung wies denselben Stil auf wie die bunten Verzierungen auf seiner Gitarre, die schon einen größeren Taifun zwei Meter unter Schlamm begraben überlebt hatte und deshalb krumm und schief und unbespielbar als Dekorationsobjekt in einer Ecke seiner Hütte stand. Ich fragte ihn daher, ob er auch malen würde.
“I not do anymore”, knurrte er, ließ sich aber schließlich entlocken, dass er früher viele Bilder, vor allem von der Bucht und den örtlichen Pflanzen, gemalt, aber alle an Freunde verschenkt habe, sodass er mir keines mehr zeigen könne. Früher habe er auch viel nachgedacht und alles, was ihm so eingefallen sei, neben vielen Zeichnungen in ein großes Buch eingetragen, dessen Blätter sich aber genauso in alle Winde verstreut hätten wie die Bilder. Er habe das Buch diesem mitgegeben, an jenen verliehen und einem Dritten daraus vorgelesen, und alle hätten sie Seiten herausgerissen und wären auf Nimmerwiedersehen damit verschwunden.
Was stand denn in dem Buch drin, wollte ich wissen.
Er zuckte mit den Schultern.
“Life”, sagt er schließlich, das Leben.
Und wo war es hin?
Seine Hand machte einen großen Kreis.
“Eeev-lywhere”, üüüberall …
Das war das letzte Mal, dass ich Thom gesehen habe. Er verstand sich mit den Eignern der Bungalowanlage nicht besonders gut, und am nächsten Tag geriet er in einen derart heftigen Streit mit ihnen, dass er nachts den Pickup stahl, nach Naathon raste und sich mit der nächsten Wagenfähre aufs Festland absetzte. Dhin verlor ebenfalls ihre Stellung, und ich musste am Tag der Abreise noch zu der Hütte auf dem verlassenen Baugrundstück laufen, um ihr auf Wiedersehen zu sagen. Sie hatte sich über Thoms Marihuana-Vorräte hergemacht und grinste mich glücklich bekifft an, als ich nach seinem Verbleib fragte. Schließlich versuchte sie, etwas auf Englisch zu sagen, aber im Gegensatz zu ihrem Mann beherrschte sie die Sprache kaum. Sie sagte es dann auf Thai, was wiederum ich nicht verstand, also nickte ich höflich lächelnd und verabschiedete mich schließlich.
Vielleicht hatte ihn ja die Reue gepackt, und er war auf dem Weg zurück in den Garten der Befreiung, vielleicht lockte ihn auch wieder Kanada, vielleicht wollte er sich aber auch nur irgendwo zu Tode trinken.
Ich jedenfalls kehrte nach Europa zurück und lebte mein Leben, verliebte mich und trennte mich wieder, jagte Luftschlössern nach oder verkroch mich mutlos in die Ecke, stürzte mich in die Arbeit oder vergeudete ganze Tage mit Nichtstun, ignorierte wahre Freunde und umwarb die falschen, erlebte mit stolzgeschwellter Brust Siege und ließ mich von Niederlagen zu Boden drücken – und hatte keinen blassen Schimmer, was das alles eigentlich sollte. Und je mehr Zeit mich von den mit Thom auf Samui verbrachten Monaten trennte, desto mehr dachte ich über ihn nach. Der Gedanke wurde geradezu übermächtig: Wenn Thom müde war, schlief er. War er hungrig, aß er. Wenn er einen faulen Tag hatte, legte er sich in die Hängematte. Hatte er Lust, mit seiner Frau zu schlafen, verführte er sie. Und wenn ihn die Gier nach Alkohol übermannte, trank er eben. Wenn ich müde war, ging ich in die Spätvorstellung ins Kino. War ich hungrig, musste ich erst einen Brief zu Ende schreiben. Meine faulen Tage legten sich schwer auf meine protestantische Arbeitsmoral, und wenn ich eine Frau verführen wollte, betrank ich mich. Hatte ich hingegen nur Lust auf ein Bier, fragte ich mein Gewissen, ob es schon früh genug am Tag dafür sei. Kurzum – Thom mochte weder Differenzialgleichungen lösen können noch sechs Sprachen beherrschen, in allen wesentlichen Belangen des Lebens war er mir meilenweit voraus. Er hätte mein Lehrer werden können, aber ich – der es ja immer besser wissen musste – hatte ihn nur für einen sympathischen, aber reichlich versoffenen Hallodri mit interessanter Vergangenheit gehalten, und die Gelegenheit war verpasst.
Ich wurde immer unruhiger. Ich wollte sein wie Thom – wie war Thom zu dem geworden, der er war? Die Antwort konnte nur lauten: Wat Suan Mokh! In diesem Kloster war er während seiner dreijährigen Wanderschaft am liebsten gewesen, hier musste er die wesentlichen Lehren empfangen haben, die ihn für sein weiteres Leben geprägt hatten. Erwartungsvoll zog ich Erkundigungen über den Garten der Befreiung ein und plante schon einen längeren Klosteraufenthalt, den ich in die Zeit vor dem beabsichtigten Umzug in eine andere Stadt legen wollte. Aber Gott, das Schicksal, mein Karma oder was auch immer hatten andere Pläne: Ich fand heraus, dass Buddhadasa Bhikkhu, der alte, hochberühmte Abt des Klosters, schon vor einigen Jahren verstorben war. Unter seiner Leitung musste in jenem Garten eine wahrhaft befreiende Atmosphäre geherrscht haben, die sich aus dem Besten der Theravada-Schule, den Lehren Laotses, Zen-Buddhismus und einem humanistisch verstandenen Sozialismus genährt hatte. Nach seinem Tod war aber wieder der Geist der thailändischen Orthodoxie in den Ort eingezogen, und die Jünger Buddhadasas waren fortgezogen. Wie so oft im Leben kam ich zu spät.
Ich raufte mir die Haare. Wenn ich wenigstens Thoms Buch lesen könnte … ! Dort müsste doch auch alles stehen, seine ganze Lebensphilosophie, seine Version des Juwels in der Lotosblüte, wenigstens ein kleiner Splitter von dem Diamanten, der Wat Suan Mokh einmal gewesen sein musste. Wenn ich schon nicht die Worte verstehen würde, so würden mir doch seine Bilder einen geheimen Weg weisen, vielleicht konnte ich ja sogar Thailändisch lernen, um mir die gesamte Fülle der Weisheit zu erschließen. Ich kaufte Selbstlernbücher und quälte mich durch das thailändische Lautsystem. Die Schrift erinnerte mich an verschlungene Lianen, durch die sich wilde Affenhorden durch einen bizarren Urwald schwingen. Wenn ich versuchte, die Wörter richtig auszusprechen, hörte sich das nicht an wie das sanfte Miauen der Thais selbst, sondern wie das heisere Gejaule eines streunenden alten Katers.
Die Sache fing an, aus dem Ruder zu laufen: Ich machte ohne einen Pfennig Geld in der Tasche Reisepläne, kaufte mir Landkarten und Führer. Ein ganzes Buch konnte doch nicht so einfach verschwinden … Ich musste auf Samui versuchen, seine Spur aufzunehmen und wie ein Jagdhund mit der Nase dicht am Boden jeder gefundenen Fährte folgen: Da gab es doch den Freund mit der Marihuanaplantage oben in den Bergen, einen anderen hatte ich ebenfalls kennen gelernt, der von der Häuservermietung auf dem elterlichen Grundstück lebte und fröhlich gitarrespielend und kiffend seine Tage in einer Hütte am Meer verbrachte. Die Bilder hatten vielleicht Besucher aus dem Westen mitgenommen, wenn ich die üblichen Orte in der Gegend abgraste, an denen sich junge Aussteiger auf Zeit aus Europa und Nordamerika zu versammeln pflegten, konnte ich vielleicht noch das eine oder andere wiederfinden, vergessen an der Wand im Gemeinschaftsraum einer Traveller-Absteige auf Phangan, eingeklebt in ein altes Gästebuch des Swiss Hotels in Penang, missbraucht als Verzierung auf dem Deckel einer Speisekarte im Blues Café am Toba-See, versteckt als kostbar gehüteten Schatz im Privatbesitz eines Restaurantbesitzers in Ubud auf Bali. Und wenn ich schon nichts finden würde, so wäre doch die Reise schon ein Gewinn an sich, und mit ein bisschen Glück konnte mir dabei sogar Thom selbst wieder über den Weg laufen … ! Ich würde ihn in ein Kloster im Norden bringen, bei Bangkok, ich hatte gelesen, dass dort Drogen- und Alkoholkranke von buddhistischen Mönchen mit Meditation geheilt wurden, und dann konnte er endlich mein Lehrer werden …
Am Ende holte mich das Leben wieder ein. Ich musste meine Tagträumereien begraben und mich um einen Broterwerb kümmern wie alle anderen auch, die Thai-Lehrbücher verschwanden im Regal, gleich neben die Reiseführer für Südostasien, die Flugpläne schmiss ich weg, und der ganze Plan, nach Thoms Buch zu suchen, wurde immer vager, bis die Erinnerung an dieses einst so große Vorhaben beim Gedanken daran nur noch ein schwaches, wenn auch mildes Lächeln auslöste. Thom selbst blieb mir immer präsent, immerhin. Ich schloss mich einer Sangha an, in der Zen gelehrt wurde, meditierte, sang Sutren, hatte Unterredungen mit den Dharma-Meistern und dachte mir irgendwann, dass Weisheit ja ohnehin nicht in Büchern stehe, man sie deshalb dort auch nicht finden könne, und überhaupt musste ich jetzt erst einmal herausfinden, ob ein Hund die Buddha-Natur hat oder nicht, dann würde ich schon klarer sehen.
In dieser Zeit erzählte mir eine Tante eine Geschichte von meiner Großmutter, die ein wirklicher preußischer Arahat war und schon vor vielen Jahren gestorben ist. Danach hätte diese einmal sie und meinen Onkel in der kleinen Stadt besucht, in der sich die beiden nach dem Krieg als Vertriebene eine neue Existenz aufgebaut hatten. Alle zusammen hätten im Garten gesessen und Kaffee getrunken, dann sei aber meine Großmutter unvermittelt aufgestanden und zu den gerade aufblühenden Rosenstöcken gegangen, habe dort eine besonders schöne Blüte, die ihr wohl vom Kaffeetisch aus schon aufgefallen war, eingehend betrachtet, schließlich meine Tante zu sich gewunken und geflüstert: “Ich möchte diese Rose küssen …”
Das wirkte wie ein Sprung in das kalte Wasser der Maenam-Bucht. Mit einem Mal sah ich klarer. Da ich, wie gesagt, immer alles besser wusste, hatte ich meine Großmutter bis dahin für eine herzensgute, bescheidene und aufopfernd hilfsbereite, aber doch einfache Landarbeiterfrau aus Hinterpommern gehalten. Jetzt wusste ich, dass sie in Wirklichkeit meine Lehrerin gewesen war. Ich schämte mich sehr, sie so verkannt zu haben: “Ich möchte diese Rose küssen …” Ohne es zu wissen (oder doch?) hatte sie mir nichts anders als ein Koan mit auf den Weg gegeben wie einst der Welterhabene auf dem Geierberg seinem Schüler Kashyapa, denn das war es ja, was ich selbst wollte, die Rose küssen … ! Ich musste mich nur bücken und den Mund spitzen …
Und da ging mir auf, dass sie nicht die einzige war, bei der es sich so verhielt, dass auch Thoms Buch nichts weiter war als ein einziges großes torloses Tor, durch das ich hindurchgehen konnte, ohne den Flieger nach Bangkok überhaupt besteigen zu müssen, ein Rätsel, das sich der Große Zen-Meister im Himmel listig ausgedacht hatte, um mich an der Nase herumzuführen. Ich musste Thom gar nicht mehr sehen, um ihn zu meinem Lehrer zu machen, er war es längst gewesen, und sein Buch musste ich nicht suchen, ich musste es selbst schreiben … !
Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Meister fielen mir ein, die mir auf die eine oder andere Weise einen Teil ihres Dharmas mit auf den Weg gegeben hatten: den Leiter unserer Grundschule, wenn er vor den Großen Ferien alle Schüler auf dem Pausenhof versammelte und dann “Wem Gott will rechte Gunst erweisen” auf seiner Geige anstimmte, der alte Pole mit der Auschwitz-Tätowierung auf dem Unterarm, der mich beim Autostopp in Südfrankreich mitnahm und mir lachend versicherte, aber gewiss doch, alle Menschen seien Brüder, die Gärtnereibesitzerin, für die ich früher einmal gearbeitet hatte und die nie Urlaub machte, nur jeden Morgen aufstand und den Kampf mit den Schnecken und dem steinigen Boden aufnahm, und das war alles, was sie brauchte, um glücklich zu sein, und, und, und …
Erst jetzt begriff ich, dass es beim Dharma nicht um eine exotische Philosophie geht, die man mit geheimnisvollen Ritualen in Asien erlernen und dann in Europa in verschwiegenen Zirkeln Eingeweihter in Hinterhof-Dojos pflegen muss, sondern um das Leben jedes einzelnen Menschen an jedem Ort und zu jeder Zeit der Geschichte. Dass man Achtsamkeit bei der Zen-Einkehr pflegen kann, aber noch weit mehr davon beim Kaffeekochen notwendig ist. Dass jeder Mensch das Dharma weitergeben kann, ohne je den Namen Buddha gehört zu haben.
Der beste Zen-Lehrer wäre einer, der noch nie etwas von Zen gehört hätte. Du hast ihm gestern die Hand gegeben und dich für immer von ihm verabschiedet.
(2005)