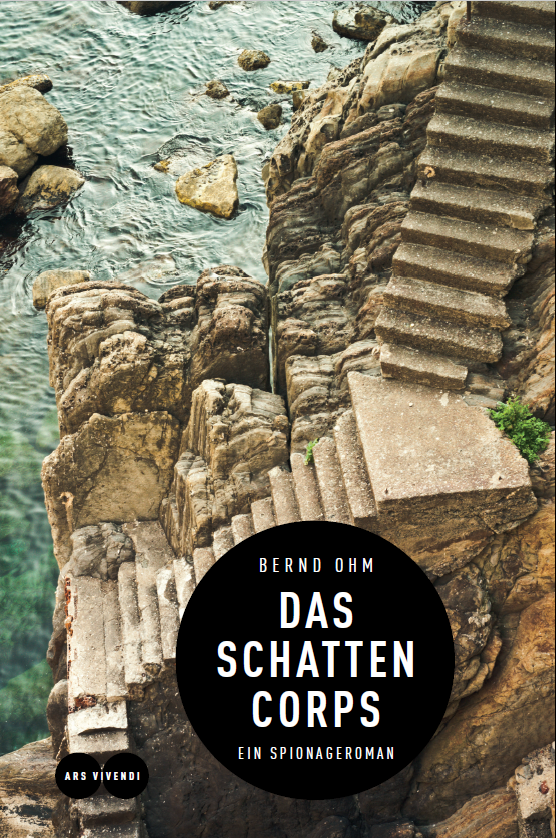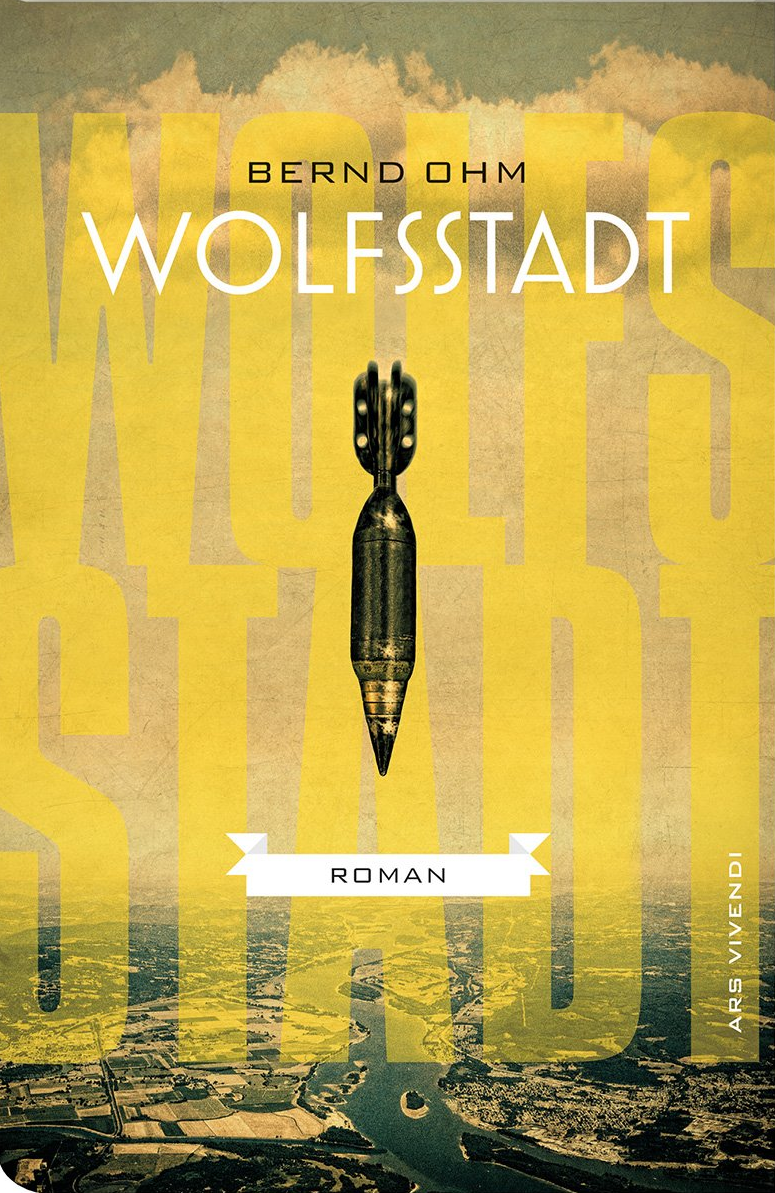Während im Netz heftig gestritten wird, ob der vorgestern verstorbene Máximo Líder der letzte der romantischen Revolutionäre war oder ein fieser Tyrann, der die Meinungsfreiheit unterdrückte, Schwule und Christen in Konzentrationslager pferchte und sich politischer Gegner durch den Einsatz von Erschießungskommandos entledigte, sollte man nicht vergessen, dass große Teile der Welt, hätte er seinen Willen durchgesetzt, seit 1962 vermutlich eine atomar verstrahlte Wüste wären.
Damals hatte die Sowjetunion, wie allgemein bekannt ist, heimlich begonnen, nukleare Mittelstreckenraketen auf der Karibikinsel zu stationieren. Das war in gewisser Weise verständlich, schließlich hatten die USA seinerzeit ähnliche Waffensysteme in der Türkei aufgestellt, und Chruschtschow wollte im Prinzip nichts weiter als das strategische Gleichgewicht wiederherstellen. Auch von kubanischer Seite aus gesehen überwogen die Vorteile, hatte es doch im Vorjahr die gescheiterte Invasion in der Schweinebucht gegeben, und die Stationierung von Atomwaffen schien eine wirksame Abschreckung gegen weitere derartige Versuche von Seiten der USA zu bieten.
Natürlich flog die Sache auf. Die Amerikaner entdeckten die Raketenstellungen auf U2-Spionageflügen und reagierten mit einer Seeblockade Kubas, die wiederum zur gravierendsten Krise des gesamten Kalten Krieges führte. Mehrere Tage lang war nicht klar, ob die USA eine militärische Invasion der Insel beginnen würden, und auch die sowjetische Führung ließ zunächst die Schiffe mit Militärausrüstung, die noch auf dem Weg nach Kuba waren, weiter Kurs auf die Insel halten. Heute wissen wir, dass eine solche Invasion von Teilen der amerikanischen Regierung und des Militärs gefordert und nur durch Kennedys Besonnenheit verhindert wurde. Wir wissen auch, dass es in dieser extrem angespannten Lage mindestens zweimal aus Versehen beinahe zu einem Atomkrieg gekommen wäre: Ein sowjetisches U‑Boot ohne Funkkontakt mit der Einsatzleitung wurde durch amerikanische Übungs-Wasserbomben zum Auftauchen gezwungen, und zwei der drei verantwortlichen Offiziere waren dafür, den an Bord befindlichen Atomtorpedo loszuschicken; nur der Flottillenkommandant Wassili Alexandrowitsch Archipow (ein Held der Menschheit, um mal pathetisch zu werden) verhinderte dies. Unbestätigten Zeugenaussagen zufolge gab es zu gleichen Zeit in einer amerikanischen Raketenstellung auf Okinawa einen Fehlalarm, der fast zum Start der dortigen Raketen geführt hätte.
In dieser Lage bewies Comandante Castro, dass er cojones in der Größe mindestens der Sierra Maestra hatte: In einem Telegramm an Chruschtschow vom 26. Oktober forderte er die Sowjetunion (ziemlich verklausuliert, aber doch deutlich erkennbar) auf, die befürchtete US-Invasion Kubas mit einem atomaren Erstschlag zu beantworten: »Por dura y terrible que sea la solución, no habría otra.« – »So hart und schrecklich die Lösung wäre, es gäbe keine andere.« (Quelle) Womit er sich durchaus im Einklang mit vielen weiteren Kubanern und Mitrevolutionären wissen konnte:
In den Straßen von Havanna skandierten begeisterte Menschen: »Que vengan! Que vengan!« — »Sollen sie doch kommen! Sollen sie doch kommen!« Und Che Guevara schrieb genauso berauscht: »Es ist das fiebererregende Beispiel eines Volkes, das bereit ist, sich im Atomkrieg zu opfern, damit noch seine Asche als Zement diene für eine neue Gesellschaft … Woran wir festhalten ist, dass wir auf dem Weg der Befreiung bleiben müssen, selbst wenn er durch einen Atomkrieg Millionen Opfer kostet, weil wir im Kampf auf Leben und Tod zwischen zwei Systemen nichts anderes denken können als den endgültigen Sieg des Sozialismus oder den Rückschritt durch den atomaren Sieg der imperialistischen Aggression.« (Hoffmann, Bert: Kuba, München 2002, S. 77)
Dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Die Russen liebten, wie es in dem schmalzigen Schlager von Sting heißt, ihre Kinder offenbar genauso wie wir und ließen sich hinter dem Rücken Castros auf einen Kuhhandel mit den Amerikanern ein, demzufolge die Raketen aus Kuba wieder abgezogen wurden, während Kennedy zähneknirschend das dortige kommunistische Regime akzeptierte und schließlich etwas später auch die amerikanischen Titan-Raketen aus der Türkei klammheimlich verschwinden ließ.
Was, wenn Chruschtschow nicht nachgegeben hätte? Irgendwann hätte sich Kennedy nicht mehr gegen die Falken im eigenen Lager durchsetzen können, und eine Invasion Kubas wäre unumgänglich geworden. Ein sowjetischer Erstschlag (damals standen 300 russische Sprengköpfe gegen 5000 amerikanische) hätte große Verwüstungen angerichtet, aber die USA hätten zweifellos noch genügend Feuerkraft gehabt, um alles zwischen Ost-Berlin und Wladiwostok (und alles zwischen Havanna und Santiago de Cuba ebenso) in eine atomar verseuchte Wüste zu verwandeln. Ob die Überlebenden sich dem Sozialismus zugewandt hätten, wissen wir nicht, aber es kann uns auch egal sein, weil es uns mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht geben würde.
In diesem Sinne: Möge er in Frieden ruhen! (Mit Betonung auf »ruhen« …)