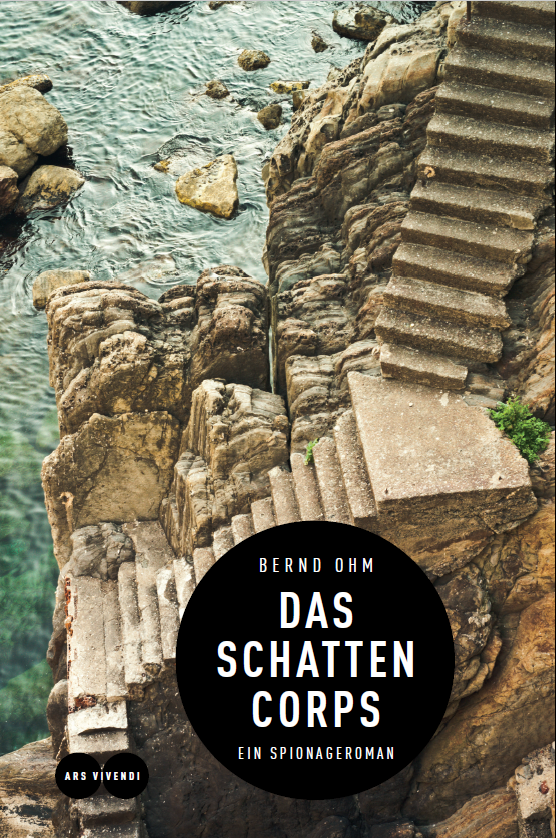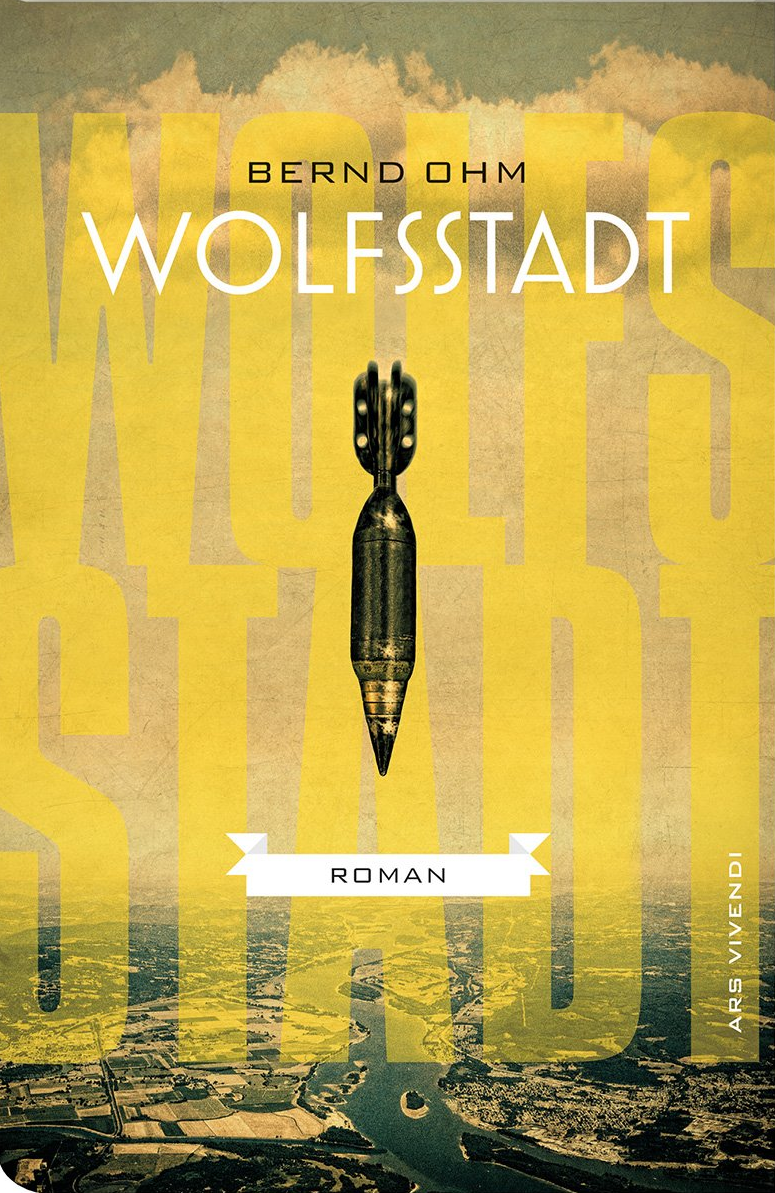Bin heute im Tagträumermodus: einmal eine Geschichte für das Fernsehen erzählen, die noch keiner erzählt hat! Mit Handlungsbögen, die sich über mehrere Folgen erstrecken, lebensnahen und doch kunstvollen Dialogen, realistischen Figuren und jeder Menge Wut über den Zustand, in dem sich das Land und unsere Gesellschaft befinden. Einmal wirklich aus dem Leben schöpfen, wie David Simon, der sich nach dem erzwungenem Ende seiner Journalistenkarriere erstmal ein Jahr lang an eine Straßenecke stellte, um die Leute zu verstehen, die dort Drogen verkauften!
Simon ist, wie inzwischen allgemein bekannt sein dürfte, der kreative Kopf hinter der US-amerikanischen Fernsehserie “The Wire”, bei der über fünf Staffeln hinweg aus verschiedenen Blickwinkeln die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Simons Heimatstadt Baltimore beleuchtet werden. Die vom Bezahlsender HBO von 2002 bis 2008 produzierte Serie ist (zumindest in ihren ersten drei Staffeln) tatsächlich das Meisterwerk der Erzählkunst, als das sie inzwischen landauf, landab angepriesen wird, und so kann es nicht verwundern, dass mittlerweile so gut wie jeder deutsche TV-Regisseur, der etwas auf sich hält und mitschnacken will, das Baltimore-Epos im Interview zu seinem neuesten Fernsehserienprojekt als Inspirationsquelle und Vorbild erwähnt.
Ganz explizit war das bei “Im Angesicht des Verbrechens” der Fall, einer ARD-Serie, die nicht nur einen selten dämlichen Titel aufwies, sondern leider auch die eigenen Ansprüche nicht halten konnte. Ja, ja, da zogen sich “Handlungsstränge über mehrere Ebenen”, und “ästhetische Kamerabilder” gab es auch, aber der Plot dreht sich wieder nur um denselben alten Quark, diesmal dargeboten in einer komplett artifiziellen Welt, die von irgendeiner “Russenmafia” handeln soll, die in irgendeiner Stadt namens “Berlin” eine irgendwie geartete “Unterwelt” beherrscht. Ach ja, und die Schwester des Polizisten ist natürlich mit dem Ober-Mafioso liiert. Jimmy McNulty, hilf! Weiterlesen